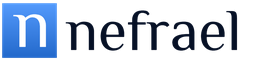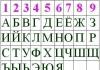Das Senden Ihrer guten Arbeit an die Wissensdatenbank ist ganz einfach. Nutzen Sie das untenstehende Formular
Studierende, Doktoranden und junge Wissenschaftler, die die Wissensbasis in ihrem Studium und ihrer Arbeit nutzen, werden Ihnen sehr dankbar sein.
Veröffentlicht am http://allbest.ru
Einführung
1. Selbstbewusstsein als höchste Stufe der Bewusstseinsentwicklung
1.1 Das Problem der Untersuchung des Selbstbewusstseins in der in- und ausländischen Psychologie
1.2 Entwicklung des Selbstbewusstseins in der Ontogenese
2. Selbstbild bei Vorschulkindern
2.1 Die innere Welt des Kindes als ganzheitliches Gebilde
2.2 Merkmale der Selbstbildbildung bei einem Vorschulkind
3. Beschreibung der Studie und Analyse der erzielten Ergebnisse
3.1 Forschungsmethoden und -techniken
3.2 Ergebnisse einer Studie zum Selbstbild bei Vorschulkindern
Literatur
Einführung
Selbsterkenntnis ist in erster Linie der Prozess, durch den eine Person sich selbst kennenlernt. Selbstbewusstsein zeichnet sich vor allem durch sein Produkt aus – die Vorstellung von sich selbst, das „Ich-Bild“. Die Vorstellung von sich selbst als Produkt des Selbstbewusstseins ist sowohl dessen wesentliche Voraussetzung als auch ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung menschlichen Verhaltens. In der Struktur des Selbstbewusstseins einer Person werden normalerweise die Hauptkomponenten unterschieden: kognitiv – das Bild der eigenen Qualitäten, Fähigkeiten, des Aussehens, der sozialen Bedeutung usw. und emotional – Selbsteinstellung, Selbstwertgefühl usw. Manchmal werden diese Komponenten als Selbsterkenntnis und Selbsteinstellung betrachtet und in den Rahmen des „Selbstkonzepts“ integriert, dessen angemessene Bildung eine Voraussetzung für die optimale Anpassung eines Menschen an das soziale Umfeld ist.
Bis zum Ende des Vorschulalters entwickeln Kinder eine erste Vorstellung von sich selbst, das sogenannte „Ich-Bild“, das es dem Kind ermöglicht, eine innere Haltung gegenüber Beziehungen zu anderen Menschen zu entwickeln. Basierend auf der inneren Position strebt das Kind danach, eine bestimmte Position unter Gleichaltrigen und Erwachsenen einzunehmen.
Die Analyse der psychologischen Forschung und der pädagogischen Praxis überzeugt uns von der Bedeutung und Notwendigkeit der Untersuchung des „Ich-Bildes“ bei Kindern. Wie ein Kind zu dieser oder jener Vorstellung von sich selbst kommt, welche inneren Handlungen es ausführt, worauf es sich verlässt – diese Fragen werden nun intensiv bearbeitet.
Es ist bekannt, dass der Prozess der Persönlichkeitsbildung komplex und vielschichtig ist. Das Alter von 5 bis 6 Jahren ist ein wichtiger Zeitraum in der allgemeinen geistigen Entwicklung eines Kindes. In dieser Zeit wurde der Grundstein für seine Vorstellungen von sich selbst gelegt. Und im Zusammenhang mit dem Übergang zum Schulbeginn für Kinder ab 6 Jahren kommt dem Problem der Selbstwahrnehmung des Kindes, seiner Stärken und Fähigkeiten eine besondere Bedeutung zu. Dies hat großen Einfluss auf den Beginn einer erfolgreichen Schulausbildung.
Gleichzeitig bleibt die wichtigste Frage, wie sich ein Mensch auf der Grundlage welcher Maßstäbe, Urteile, Schlussfolgerungen, Bilder diese oder jene Vorstellung von sich selbst bildet, trotz aller enormen Bedeutung und des großen Interesses daran ein wenig bestehen -studiertes Problem.
Dieser Widerspruch ermöglichte es, das Thema vom oben genannten Problem zu isolieren: „Merkmale der Entwicklung des Selbstbildes bei Vorschulkindern“.
Studienobjekt: Selbstbewusstsein des Kindes.
Forschungsgegenstand: Merkmale der Entwicklung des Selbstbildes bei Vorschulkindern.“
Zweck der Studie: um den psychologischen Inhalt des „Ich-Bildes“ bei Kindern im Alter von 5-6 Jahren zu bestimmen.
Basierend auf dem Ziel wurden die folgenden Aufgaben gebildet.
Forschungsschwerpunkte:
Studieren Sie die Forschungsergebnisse der in- und ausländischen Psychologie zu diesem Thema.
Planen Sie das Experiment und wählen Sie eine Reihe von Methoden und Techniken aus, die für seine Durchführung erforderlich sind.
Verarbeiten Sie die Versuchsergebnisse quantitativ und qualitativ.
Hypothese: es wird angenommen dass:
In den Köpfen von 5-6-jährigen Kindern bildet sich das „Ich-Bild“,
Das Selbstbild entsteht und formt sich im Prozess der Kommunikation zwischen dem Kind und bedeutenden Erwachsenen, die einen wesentlichen Einfluss auf den Inhalt des „Ich-Bildes“ haben.
Diese Studie wurde auf der Grundlage der Vorschuleinrichtung Nr. 369 durchgeführt. Das Alter der Kinder betrug 5-6 Jahre.
1. Selbstbewusstsein als höchste Stufe der Bewusstseinsentwicklung
1.1 Das Problem der Untersuchung des Selbstbewusstseins in der in- und ausländischen Psychologie
Viele Forschungen in der russischen Psychologie widmen sich dem Problem des Selbstbewusstseins. Diese Studien konzentrieren sich hauptsächlich auf zwei Gruppen von Fragen. In den Werken von B.G. Ananyeva, L.I. Bozovic, L.S. Wygotski [17, 19], A.N. Leontyev [35], S.L. Rubinsteina, A.G. Spirkina, V.V. Stolina, P.R. Chamaty, I.I. Chesnokova analysierte die Frage der Bildung des Selbstbewusstseins im Kontext eines allgemeineren Problems der Persönlichkeitsentwicklung unter allgemeinen theoretischen und methodischen Aspekten. Eine andere Gruppe von Studien untersucht speziellere Fragen, die sich hauptsächlich auf die Merkmale des Selbstwertgefühls und deren Beziehung zu den Einschätzungen anderer beziehen. Forschung von A.A. Bodalev über soziale Wahrnehmung schärfte das Interesse an der Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Wissen anderer Menschen und der Selbsterkenntnis.
Werke von I.S. Kona, in dem philosophische, allgemeine und sozialpsychologische, historische und kulturelle Aspekte, theoretische Fragen und die Analyse spezifischer experimenteller Daten erfolgreich synthetisiert wurden, eröffnete viele neue Facetten dieses vielleicht ältesten Problems der Psychologie. Die ausländische Literatur zu Themen der Psychologie des Selbstbewusstseins ist äußerst umfangreich – es genügt, nur auf einige kürzlich veröffentlichte Monographien hinzuweisen, die mit einer umfangreichen Bibliographie ausgestattet sind [zitiert nach: 51]. Die Konzepte „Ich“ und Selbstbewusstsein gehören auch zu den zentralen Konzepten in der Literatur, die sich den theoretischen und praktischen Aspekten der Psychotherapie und psychologischen Beratung widmet. A. N. Leontiev, der das Problem des Selbstbewusstseins als ein Problem von „hoher lebenswichtiger Bedeutung, das die Persönlichkeitspsychologie krönt“, betrachtete es jedoch als Ganzes als ungelöst, „das sich einer wissenschaftlichen und psychologischen Analyse entzieht“.
Der psychologische Aspekt der Untersuchung des Problems des Selbstbewusstseins besteht darin, die Besonderheiten des Selbstbewusstseins als einen besonderen Prozess der menschlichen Psyche aufzudecken, der auf die Selbstregulierung eines Individuums seiner Handlungen im Bereich des Verhaltens und der Aktivität auf dem Gebiet abzielt Grundlage der Selbsterkenntnis und einer emotional-wertvollen Einstellung zu sich selbst.
Das Studium der Selbstwahrnehmung als mentalen Prozess stellt sie nicht auf eine Stufe mit anderen mentalen Prozessen – Wahrnehmung, Denken, Gedächtnis, obwohl sie nur auf ihrer Grundlage existieren und sich durch sie manifestieren kann. Der psychologische „Mechanismus“ der Selbsterkenntnis ist integrativer Natur. Jeder Akt der Selbsterkenntnis umfasst nicht nur einzelne mentale Prozesse in ihren verschiedenen Kombinationen, sondern auch die gesamte Persönlichkeit als Ganzes – das System ihrer psychologischen Eigenschaften, Motivationsmerkmale, erworbenen Erfahrungen auf verschiedenen Generalisierungsebenen und schließlich das Emotionale Zustand des Einzelnen im Moment. Im Seelenleben des Einzelnen, in seiner Struktur, ist das Selbstbewusstsein neben dem Bewusstsein sozusagen ein zentrales Gestaltungsmittel. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die Integrität und Kontinuität der Gestaltung der inneren Welt des Einzelnen.
Eine der ersten, methodisch wichtigen Fragen bei der Analyse des Selbstbewusstseinsproblems ist die Klärung des Zusammenhangs zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein. Ihrem Ursprung nach handelt es sich um mentale Phänomene einer Ordnung, deren Wesen nur auf der Grundlage der Reflexionstheorie verstanden werden kann. Trotz der Spezifität von Manifestationen und Entwicklungen können sie nur in der Abstraktion getrennt werden, da sie im wirklichen Leben eines Individuums intern vereint sind – in den Prozessen des Bewusstseins ist Selbstbewusstsein in Form des Bewusstseins der Zuschreibung des vorhanden Bewusstseinsakt gegenüber meinem „Ich“, und die Prozesse der Selbsterkenntnis können nur auf der Grundlage des Bewusstseins durchgeführt werden.
Das Selbstbewusstsein entsteht in einer mehr oder weniger ausgeprägten Form seiner Manifestation ontogenetisch, etwas später als das Bewusstsein. Diese Tatsache hat einige Forscher dazu veranlasst, zu argumentieren, dass Selbstbewusstsein die höchste Ebene des Bewusstseins ist. Einer solchen Meinung kann man kaum zustimmen, denn trotz der gemeinsamen genetischen Natur haben die untrennbaren Beziehungen im Prozess der Bildung, des Bewusstseins und des Selbstbewusstseins einzigartige „Ebenen“, Entwicklungslinien, die diese mentalen Phänomene „trennen“.
Über die Ebenenbeziehung zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein zu sprechen bedeutet, eine Analyse innerhalb der Kategorien „niedriger-höher“, „einfach-komplex“ durchzuführen. Offensichtlich ist diese Analysemethode exklusiv, da diese beiden mentalen Phänomene selbst recht komplex sind und jedes von ihnen ein mehrstufiges System darstellt. Die Prozesse des Bewusstseins in ihren höchsten Erscheinungsformen offenbaren die subtilste adaptive und regulierende Aktivität, die in ihrer Komplexität den Akten des Selbstbewusstseins in nichts nachsteht.
Selbstbewusstsein ist jedoch kein eigenständiges Phänomen der Psyche. Es ist das gleiche Bewusstsein, nur mit einer anderen Ausrichtung. Ein Mensch erkennt nicht nur den Einfluss von Objekten in der realen Welt und drückt durch seine Erfahrungen seine Einstellung zu ihnen aus, sondern erkennt, indem er sich von dieser Welt isoliert und sich ihr widersetzt, auch sich selbst als Person, seine Eigenschaften und Originalität und bezieht sich in gewisser Weise auf sich selbst. Wenn das Bewusstsein auf die gesamte objektive Welt ausgerichtet ist, dann ist das Objekt des Selbstbewusstseins die Persönlichkeit selbst. Im Selbstbewusstsein fungiert sie sowohl als Subjekt als auch als Objekt des Wissens.
Aus Sicht der psychologischen Analyse ist Selbsterkenntnis ein komplexer mentaler Prozess, dessen Kern darin besteht, dass der Einzelne zahlreiche „Bilder“ seiner selbst in verschiedenen Aktivitäts- und Verhaltenssituationen, in allen Formen der Interaktion mit anderen Menschen wahrnimmt und in der Kombination dieser Bilder zu einer einzigen ganzheitlichen Formation – in der Darstellung und dann zum Konzept des eigenen „Ich“ als einem von anderen Subjekten unterschiedenen Subjekt. Durch umfangreiche Selbsterkenntnisprozesse, die mit zunehmender Anzahl der in die Vorstellung und Vorstellung von sich selbst integrierten Bilder immer komplexer werden, entsteht ein immer perfekteres, tieferes und adäquateres Bild des eigenen Selbst Strukturell gesehen ist Selbstbewusstsein die Einheit dreier Seiten – kognitiv (Selbsterkenntnis), emotional-wertvoll (Selbsteinstellung) und effektiv-willkürlich, regulierend (Selbstregulierung).
Es gibt eine Vorstellung, dass die Entstehung des Selbstbewusstseins bereits mit der intrauterinen Entwicklung verbunden ist; Die wichtigste Rolle spielen dabei taktile Kontakte, die das Gefühl für die Grenzen des eigenen Körpers vorbereiten. Obwohl fast alle Autoren die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen für die Entwicklung des Selbstbewusstseins betonen, werden die Einflussmechanismen der Beziehung des Kindes zu einem Erwachsenen und dementsprechend die Form der Entstehung des Selbstbewusstseins und das Alter seiner Entstehung unterschiedlich gedacht . Autoren, die sich in der psychoanalytischen Tradition mit der kindlichen Entwicklung befassen, verstehen den Prozess der Entstehung des Selbstbewusstseins als einen Prozess der subjektiven Trennung von der Mutter; Beschwerden, die durch bestimmte somatische Prozesse verursacht werden, nehmen beim Kind mit dem Erscheinen einer Mutter ab; Dementsprechend beginnt das Kind, die Mutter vom Rest der Welt zu isolieren und sich von der Mutter zu trennen.
Derzeit besteht in der russischen Psychologie noch kein Konsens über den Anfangszeitpunkt und die Kriterien für die Entstehung des Selbstbewusstseins in der Ontogenese. Nach Ansicht von B. G. Ananyev entsteht Selbstbewusstsein in der Zeit, in der das Kind beginnt, sich als Subjekt seiner Handlungen zu identifizieren. Die Grenzen dieses Zeitraums sind jedoch sehr vage, weshalb eine endgültige Lösung dieser Frage laut Ananyev in diesem Stadium der Erforschung des Problems des Selbstbewusstseins noch immer unmöglich ist.
Unvollkommene Formen des Selbstbewusstseins treten bei einem Kind bereits in den ersten Lebensjahren auf. Diese Formen werden durch einen gewissen Grad der Beziehung zur Außenwelt und entsprechende Momente der körperlichen und geistigen Entwicklung bestimmt. Zunächst wird das körperliche „Ich“ des Kindes hervorgehoben, das auf seiner Reflexion seiner körperlichen Qualitäten und Fähigkeiten, den Eigenschaften seines Körpers, basiert.
Die Entwicklung und Veränderung des „Ich“ vollzieht sich kontinuierlich mit der körperlichen und geistigen Entwicklung des Einzelnen. Das „Ich“ eines Kindes, das „Ich“ eines Erwachsenen und das „Ich“ des Alters haben unterschiedliche inhaltliche Merkmale. Auch für die gleiche Altersperiode einer Persönlichkeit ist das „Ich“ je nach Ausprägung der Erfahrungen, je nach emotionalem Hintergrund aller Persönlichkeitszustände, nicht gleich. Die Variabilität und Labilität des „Ich“ bedeutet keineswegs, dass ein Mensch mehrere „Ich“ hat. Tatsache ist, dass sich nicht alles in der Struktur des „Ich“ gleichermaßen verändert; der Teil, der sich am meisten verändert, ist der, der nicht mit den wesentlichen Merkmalen der Persönlichkeit zusammenhängt. Letztere wiederum befinden sich im Laufe des Lebens des Einzelnen in einem Zustand ständiger Klärung, Vertiefung und Bereicherung und behalten gleichzeitig eine gewisse Identität, die die Individualität des Einzelnen, seine Einzigartigkeit schafft.
Mit der Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten des kindlichen Bewusstseins und der Erweiterung seines Tätigkeitsbereichs erhält das Selbstbewusstsein neue Eigenschaften und verändert sich im Jugendalter erheblich. Es ist in das mentale Leben des Einzelnen eingebunden und untrennbar mit allen anderen mentalen Prozessen (kognitiv, affektiv, willentlich) verbunden.
1. 2 Entwicklung des Selbstbewusstseins in der Ontogenese
Selbsterkenntnis ist ein komplexer mentaler Prozess, der sich vor allem in der Wahrnehmung zahlreicher „Bilder“ von sich selbst in verschiedenen Aktivitäts- und Kommunikationssituationen manifestiert. Diese „Bilder“ entstehen zunächst auf der Grundlage des Bewusstseins einer bestimmten Person für die Einschätzungen anderer Menschen über sie, dann auf der Grundlage einer Korrelation zwischen den Einschätzungen anderer und der eigenen. Mit anderen Worten: Sie sind immer das Ergebnis sozialer Interaktion zwischen dem Individuum und seiner Umwelt. Primäre Bilder von sich selbst, reich an Sinnesinhalten, werden in ein einziges ganzheitliches Gebilde integriert – in die Idee und dann in das Konzept des eigenen Selbst als eines Subjekts, das sich von anderen unterscheidet. In der Bewegung von einzelnen, situativen Selbstbildern hin zur Identifizierung dessen, was an einem selbst wesentlich und einzigartig ist, vollzieht sich der Prozess der Selbsterkenntnis.
Die Bildung des Selbstbewusstseins in der Ontogenese durchläuft eine Reihe von immer komplexeren Stadien, die mit den Altersstufen der geistigen Entwicklung des Menschen verbunden sind. Herkömmlicherweise lassen sich bei der Entwicklung des Selbstbewusstseins folgende ontogenetische Hauptstadien unterscheiden (Grundlage für die vorgeschlagene Einteilung können die sogenannten „Krisenpunkte“ der Persönlichkeitsentwicklung sein): von der Geburt bis zum 1. Lebensjahr; von 1 Jahr bis 3 Jahren; von 3 bis 7 Jahren; von 7 bis 12 Jahren; von 12 bis 14 Jahren; von 14 bis 18 Jahren. Abhängig von den individuellen Merkmalen der geistigen Entwicklung können sich diese Altersstufen verschieben.
Betrachten wir die Merkmale einiger der wichtigsten Phasen des Selbstbewusstseins für die Persönlichkeitsentwicklung. Die Entwicklung des Selbstbewusstseins beginnt in den frühesten Stadien der Ontogenese im Prozess der Abgrenzung des Kindes von der Welt der Objekte und anderer Menschen. Er unterscheidet sich zunächst nicht von anderen. Er kann seine eigenen Bewegungen, die er macht, nicht von denen unterscheiden, die ihm gehören, aber sie werden von einem Erwachsenen bei der Betreuung eines Kindes ausgeführt. Die ersten Spiele des Kindes, zunächst mit Körperteilen (Armen, Beinen) und dann mit Objekten der Außenwelt, weisen auf die primäre Differenzierung seiner aktiven und passiven Rolle bei der motorischen Aktivität hin. Im Prozess der motorischen Aktivität, bei der Manipulation von Gegenständen und im Verlauf der Beziehungen zu Erwachsenen werden nach und nach das körperliche „Ich“ des Kindes, einzelne Sinnesorgane und Körperteile verwirklicht. Wahrnehmungs- und motorische Erfahrungen ermöglichen es dem Kind, seine sensorischen und motorischen Fähigkeiten zu verwirklichen. Durch die Synthese individueller Ideen entwickelt es ein primäres Bild seines eigenen Körpers, das sich in der Fähigkeit ausdrückt, Körperteile zu kontrollieren und willkürliche Bewegungen auszuführen. Gleichzeitig trennt sich das Kind auch von dem Raum, in dem es sich befindet.
Mit der Abgrenzung des Körpers vom umgebenden Raum wird er auch von der Welt der unbelebten Objekte abgegrenzt. Wenn Dinge den Wunsch hervorrufen, mit ihnen in Kontakt zu treten oder sie einzufangen, erhalten sie eine „Hülle, die sie isoliert“. Durch das Handeln mit Objekten und das Erkennen von Veränderungen in der Außenwelt als Folge dieser Handlungen lernt das Kind nicht nur den Gegenstand, mit dem es manipuliert, sondern auch sich selbst: Indem es seine Handlungen mit Objekten erkennt, erkennt es auch, dass es die Ursache dafür ist Aktionen.
Eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung des Selbstbewusstseins ist die Entwicklung der Fähigkeit eines Kindes, sich selbstständig im Raum zu bewegen. Diese Tatsache führt zu neuen Beziehungsformen zu Erwachsenen, die neue Wege und Quellen der Erkenntnis der eigenen Fähigkeiten eröffnen, die Grenzen der Selbsterkenntnis und die Qualität eines eigenständigen Fachs erweitern.
Von besonderer Bedeutung für die Weiterentwicklung des Selbstbewusstseins ist die Entstehung und Entwicklung der Sprache, die das Kind auf einer qualitativ neuen Ebene in den Bereich seiner Beziehungen zu Erwachsenen und anderen Kindern einbezieht. Basierend auf der mnemonischen Funktion der Sprache erinnert er sich an Episoden und Ereignisse aus seinem Leben, sammelt nach und nach kognitive und affektive Erfahrungen über sich selbst und die Entwicklung komplexerer Denkformen ermöglicht es ihm, diese Erfahrungen mit unterschiedlichem Grad der Verallgemeinerung darzustellen.
Die Weiterentwicklung des Selbstbewusstseins von Kindern ist mit der Identifizierung von Motiven für die durchgeführten Handlungen und deren Regulierung im Laufe der Zeit verbunden. Motive äußern sich hauptsächlich in den Wünschen des Kindes. „Das Bewusstsein für einen Wunsch, seine Zuschreibung an sich selbst, das Bewusstsein für das Handeln als Mittel zur Erfüllung dieses Wunsches ist mit der Formulierung des Ziels seines Handelns durch das Kind verbunden, mit der Fähigkeit, dieses Ziel zu bewahren und praktisch zu verwirklichen.“ Das Bewusstsein für die eigenen Handlungen, die Ziele der eigenen Aktivitäten und die Motive des eigenen Verhaltens bedeutet den Beginn der Bildung des psychologischen „Ichs“ des Kindes. Und obwohl die allerersten Formen der Motivation für die Handlungen eines Kindes noch unvollkommen sind – die Motive des Kindes auf den frühen Ebenen der Ontogenese sind noch instabil und impulsiven Einflüssen ausgesetzt, erfolgt die Identifizierung der Das geistige „Ich“ des Kindes beginnt.
Das dritte Lebensjahr ist eine Zeit intensiver geistiger Entwicklung. Wenn das Kind zuvor nicht getrennt von den üblichen Bedingungen an sich selbst dachte, ein Gefühl der Einheit mit der Umwelt erlebte, sich beim Namen nannte, in der dritten Person über sich selbst sprach, dann im Alter von 3 Jahren „diese Verschmelzung des Kindes mit.“ Die Umgebung verschwindet plötzlich und die Persönlichkeit tritt in eine Phase ein, in der das Bedürfnis, seine Unabhängigkeit durchzusetzen und zu gewinnen, das Kind in eine Reihe von Konflikten führt. Erstens ist es ein Kontrast zu anderen, oft völlig negativ. Infolgedessen beleidigt das Kind unfreiwillig die Menschen um es herum, nur weil es seine eigene Unabhängigkeit erleben und seine eigene Existenz spüren möchte. In diesen Fällen ist der Sieg selbst die einzige Form der Selbstbestätigung. Durch den stärkeren Willen eines anderen Menschen oder durch die Notwendigkeit besiegt, erfährt das Kind schmerzlich die Herabwürdigung seines Wesens.“
Die Manifestation von Negativismus und Eigenständigkeit in dieser Zeit kann als eine Art „Übung“ des Kindes angesehen werden, seine Fähigkeiten und deren Grenzen kennenzulernen.
Dies ist die Zeit, in der sich in der mentalen Welt des Einzelnen moralische Systeme und Komplexe herausbilden, die sich später zu dauerhaften Persönlichkeitsmerkmalen entwickeln können. In diesem Stadium wird die Art der Beziehung des Kindes zu einem Erwachsenen entscheidend. Da das Kind noch nicht über ausreichende Selbstkenntnis und Selbsthaltung verfügt, akzeptiert es spontan die Haltung eines nahestehenden Erwachsenen (Mutter, Vater etc.). So wird die „treue“ Haltung eines Erwachsenen zur Quelle des anfänglichen Selbstwertgefühls seiner Persönlichkeit. Beispielsweise kann ein unzureichend hohes Selbstwertgefühl durch ständiges, oft grundloses Lob eines Kindes verursacht werden, und im Gegenteil kann die Betonung negativer Aspekte im Verhalten und Handeln des Kindes (oft falsch) zu Unglauben an seine Stärken und Fähigkeiten führen zur Bildung einer negativen Einstellung sich selbst gegenüber, zu fesselnder Aktivität und Unwilligkeit, das Beste anzustreben. „...Die Einstellung zu sich selbst als unverbesserlich oder besonders brillant ist ein etabliertes einzigartiges Stereotyp der Einstellung einer Person gegenüber anderen und gegenüber sich selbst und ist, wie alle Stereotypen, ein direktes Produkt, eine direkte Folge des Kommunikations- und Aktivitätssystems, das sie hervorbringt die Lebensweise des Kindes verbessern... Im Lebensstil des Kindes und insbesondere in der Art seiner Kommunikation mit seinen Mitmenschen liegen die wesentlichen und bestimmenden Gründe für kindliches Verhalten, kindlichen Charakter und kindliche Neigungen.“
Die Entwicklung des Selbstbewusstseins nach 3 Jahren geht in Richtung einer zunehmenden Selbstbestätigung der Persönlichkeit des Kindes, es kommt zu einer weiteren Anhäufung seiner kognitiven, affektiven und willentlichen Erfahrungen, die sich in einer Steigerung der Angemessenheit des Selbstwertgefühls äußert .
Im Zeitraum von 7 bis 12 Jahren verläuft der Prozess der Entwicklung des Selbstbewusstseins reibungslos, ohne spürbare Sprünge und Krisen. Zu diesem Zeitpunkt sammeln sich mentale Reserven an, die das Selbstbewusstsein im Jugendalter zu seiner wichtigsten genetischen Form bringen.
Das Selbstbewusstsein eines Teenagers ist durch signifikante, ausgeprägte Veränderungen gekennzeichnet. Dieser Umstand führt oft zu der Meinung, dass Selbstbewusstsein erstmals bei einem Teenager auftritt. Tatsächlich handelt es sich um eine weitere, wenn auch für die geistige Entwicklung des Individuums äußerst bedeutsame Stufe des Selbstbewusstseins, die nur auf der Grundlage der in früheren Perioden gesammelten kognitiven, emotionalen und regulatorischen Erfahrung des Selbstbewusstseins gebildet wird, die zu einem geworden ist potenzielle Reserve für die Weiterentwicklung. Die Adoleszenz ist die zweite kritische Phase (nach der dreijährigen Krise) in der geistigen Entwicklung eines Kindes, die für die Entstehung des Selbstbewusstseins von wesentlicher Bedeutung ist. Auf die Stufen mit Krisen von 1 Jahr und 7 Jahren als weniger wichtig für die Genese des Selbstbewusstseins gehen wir bewusst nicht ein. Für diese Zeiträume ist die Kenntnis des Kindes über seine äußere Existenz, die weitere Entwicklung seiner Beziehungen zur materiellen und sozialen Welt die Hauptsache, und die Entwicklung des Selbstbewusstseins verläuft zu diesem Zeitpunkt reibungslos und ohne ausgeprägte Sprünge.
Mit 12 Jahren richtet sich die Aufmerksamkeit des Kindes wieder auf seine eigene Persönlichkeit. Allerdings entwickelt sich die neue Krise in die entgegengesetzte Richtung zur früheren. Es beginnt ebenfalls mit einem Kontrast, der jedoch nicht so sehr auf die Menschen selbst abzielt, sondern auf die mit ihnen verbundenen Gewohnheiten, Einstellungen und Erscheinungsformen im größeren Kontext moralischer Normen und Positionen. Wenn ein dreijähriges Kind danach strebt, einen Erwachsenen nachzuahmen, möchte ein Teenager im Gegenteil anders sein, sich ihm widersetzen, unabhängig sein. Wenn bei einem dreijährigen Kind die Unabhängigkeit im Bereich der Durchführung praktischer Handlungen behauptet wird, drückt sich der Wunsch nach Unabhängigkeit bei Jugendlichen in der Entstehung eines Bewusstseins für ihre Beteiligung an Erwachsenen aus, obwohl dieses Bewusstsein oft der Realität widerspricht Fähigkeiten des Teenagers.
Für die Entwicklung der Persönlichkeit ist das Teenagerstadium der Genese des Selbstbewusstseins von besonderer Bedeutung, da es in diesem Stadium eine qualitativ neue Ebene erreicht und den Beginn seiner Reife markiert. Der Zusammenhang zwischen der Genese des Selbstbewusstseins und der allgemeinen geistigen Entwicklung des Einzelnen wird anders. Nun spiegelt das Selbstbewusstsein nicht nur die Besonderheiten der Persönlichkeitsbildung wider, sondern beeinflusst maßgeblich den gesamten Prozess ihrer weiteren Bildung. Daher wird die Teenagerphase der Selbsterkenntnis nicht nur die Wege ihrer weiteren Entwicklung, sondern in größerem Maße auch die geistige Entwicklung des Einzelnen als Ganzes bestimmen.
Somit kommt es beim Übergang von einer Stufe zur anderen zu einer konsequenten Komplikation, Erweiterung des Tätigkeitsbereichs und einer Zunahme der Rolle des Selbstbewusstseins im Prozess der allgemeinen geistigen Entwicklung des Einzelnen.
Selbsterkenntnis im ontogenetischen Sinne kann also als ein sich im Laufe der Zeit allmählich entfaltender integrativer mentaler Prozess betrachtet werden, der auf der immer komplexer werdenden Aktivität der Selbsterkenntnis, der emotionalen und wertebasierten Einstellung zu sich selbst und der Fähigkeit zur Verhaltensregulierung basiert Aktivitäten. Der Bereich des Selbstbewusstseins erweitert sich kontinuierlich durch das Verständnis der Vergangenheit und die Planung für die Zukunft.
2. Selbstbild bei Vorschulkindern
2.1 Die innere Welt des Kindes als ganzheitliches Gebilde
Die Entwicklung der Grundlagen der Entwicklung der kindlichen Psyche, insbesondere seines Selbstbewusstseins, durch Psychologen ermöglichte die Entdeckung, dass das Kind durch die Kommunikation mit Erwachsenen und Gleichaltrigen ein Bild von „Ich“ entwickelt, das im Alter von fünf Jahren ist bereits eine ziemlich stabile Formation vorhanden.
In dieser Hinsicht erhält die innere Welt des Kindes nicht nur eine für ihn qualitativ neue subjektive Färbung, sondern wird auch zum wichtigsten Regulator der Lebensaktivität. Daher berücksichtigen auch Kinder im Grundschulalter bei allen Maßnahmen ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dies deutet darauf hin, dass sie mehr oder weniger realistische Vorstellungen von sich selbst haben. Die Bildung von Vorstellungen über sich selbst, die den tatsächlichen Fähigkeiten des Kindes entsprechen, setzt laut Chamata P.R. „eine harmonische Kombination der Informationen, die das Kind im individuellen Erleben erwirbt, mit den Einschätzungen und dem Wissen über sich selbst voraus, die es durch Kommunikation ansammelt“ [62, S.48].
In den Studien von S.G. Jacobson enthüllte eine Tatsache, die auf den inneren Widerstand des Kindes gegenüber einer negativen Beurteilung durch andere hinweist. Damit ein Kind seine negativen Handlungen erkennt, ist es notwendig, dass seine Umgebung – Erwachsene und Gleichaltrige – die Übereinstimmung der Persönlichkeit des Kindes als Ganzes mit einem positiven Standard erkennt und betont. Die Position des Kindes im Falle einer negativen Beurteilung durch andere ist in erster Linie „die positive Vorstellung von sich selbst, das positive Selbstbild, das der überwiegenden Mehrheit der Vorschulkinder innewohnt“ 62, S. 52 . Gleichzeitig wird in der Arbeit betont, dass nur die Überwindung des Widerspruchs des Kindes zwischen einer positiven Einstellung zu sich selbst im Allgemeinen und einer negativen Einstellung, die mit der Bewertung seines individuellen Handelns verbunden ist, als Mechanismus für die Bildung eines Verhaltens dient, das moralischen Standards entspricht.
Die Aufmerksamkeit der Forscher richtet sich in erster Linie darauf, die Merkmale der Interaktion eines Kindes mit seinen Mitmenschen – Erwachsenen und Gleichaltrigen – unter dem Gesichtspunkt seines Selbstbewusstseins als Subjekt dieser Interaktion aufzudecken.
Wenn man sich dem Studium des Selbstbewusstseins von Kindern nähert, besteht erstens die Einstellung, dass die Welt der menschlichen Individualität, die durch objektive Bedingungen bedingt ist, dennoch durch die eigene kreative Aktivität des Einzelnen geschaffen wird, und zweitens seine Selbstbewegung am vollständigsten verwirklicht wird die Notwendigkeit, nicht einzelne Manifestationen des Selbstbewusstseins des Kindes zu berücksichtigen, sondern beim Studium seiner inneren Welt als Integrität. Integrität – spiegelt eine gewisse Vollständigkeit, innere Einheit einer bestimmten Formation, ihre Autonomie und Unabhängigkeit von der Umwelt wider.
Die Anwendung dieses Ansatzes auf die Untersuchung des Selbstbewusstseins von Vorschulkindern eröffnet Perspektiven, die Besonderheiten der inneren Welt der heranwachsenden Persönlichkeit, ihrer Funktionen und Entwicklungsbedingungen aufzudecken.
Lassen Sie uns das Konzept der „inneren Welt“ erweitern und seine wesentlichen Merkmale hervorheben. Die Innenwelt des Kindes spiegelt die objektiven Bedingungen seiner Existenz in der Außenwelt wider und ist relativ autonom. Autonomie manifestiert sich, wenn das Kind ständig aktiv ist und auf Selbsterkenntnis und Selbstbestätigung in der umgebenden sozialen Mikroumgebung abzielt.
Selbsterkenntnis und Selbstbestätigung sind integrale Aspekte des Prozesses der Bildung eines Kindes als soziales Wesen, als Individuum und entstehen nur unter dem Einfluss der bewertenden Haltung von Erwachsenen im Prozess der Kommunikation mit dem Kind. Die Einstellung eines Erwachsenen zu einem Kind impliziert die Möglichkeit, dass das Kind eine Selbsteinstellung entwickelt, also eine „innere Sicht“ auf sich selbst als Objekt der Erkenntnis und Erfahrung. Psychologin V.S. Mukhina schreibt: „Im Säuglingsalter kennt sich das Kind noch nicht. Das Kind studiert sich im Spiegel und betrachtet das Foto genau, und dann erwartet es eine neue Aufgabe: Es muss sich in der Mitte seiner Umgebung wiederfinden. Mutter, Vater, manche Onkel, manche Tante, manche tauchen oft auf, andere selten – voller mysteriöser Persönlichkeiten, deren Herkunft unklar und deren Taten rätselhaft sind.“ Und weiter: „Aber sobald das Kind feststellt“, schreibt der Autor, „dass die Mutter da ist, um seine Wünsche zu erfüllen oder sich ihnen zu widersetzen, bringt der Papa Geld und die Tanten bringen Pralinen, wie in seinen Gedanken, irgendwo in sich hinein.“ es eröffnet eine neue, aber erstaunliche unsichtbare Welt.“
Die innere Welt ist ihrem Ursprung und Inhalt nach sozial. Sein Auftreten hängt mit der Art der Haltung zusammen, die die Menschen um sie herum dem Kind gegenüber an den Tag legen und verschiedene Formen kindlicher Aktivitäten befürworten oder verurteilen. Daher die entscheidende Rolle der sozialen Mikroumgebung bei der Bildung der Vorstellungen eines Kindes über sich selbst.
Durch die Haltung gegenüber dem Kind helfen Erwachsene ihm, sich zu orientieren, sich wie in einem Spiegel in einer anderen Person zu sehen, es mit Bewertungsstandards, Maßstäben und Wissen über andere Menschen auszustatten. Erwachsene tragen je nach Erziehungsstil zur Entstehung eines hohen oder unzureichend hohen Selbstwertgefühls eines Kindes bei, verursachen seine Erfahrungen, die mit Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit sich selbst verbunden sind, Gedanken, die auf den Vergleich mit anderen Kindern abzielen, Erwartungen im Zusammenhang mit möglichen Handlungen (in Bezug auf sich selbst) von denen um ihn herum. In allen Fällen wecken Erwachsene die Aktivität des Kindes, deren Objekt nicht die äußere objektive Welt wird, sondern es selbst als Subjekt der Interaktion mit dieser Welt. Alle Aktivitäten und Erfahrungen des Kindes, die im Prozess der Interaktion mit dem umgebenden sozialen Umfeld entstehen, werden dank der bewertenden Einflüsse der Menschen um es herum und insbesondere der nahestehenden Erwachsenen um das „Ich“ des Kindes herum gruppiert und konzentriert.
Im Alter von 2,5 bis 3 Jahren findet der Prozess der intensiven Gestaltung der inneren Welt des Kindes als ganzheitliche Gestaltung statt. Es kommt zu einem äußeren Übergang zum „Ich“, und dahinter verbergen sich tiefgreifende Veränderungen im Selbstbewusstsein des Kindes als Subjekt des Handelns , Wünsche und Erfahrungen. Gleichzeitig beeinflusst die Bewusstseinsform des Kindes seinen psychologischen Inhalt. B.G. Ananyev glaubte, dass die Verwendung des Pronomens „Ich“ den Übergang des Kindes von der Vorstellung von sich selbst zur Vorstellung von sich selbst anzeigt.
Mit der Manifestation der Selbständigkeit bei Vorschulkindern erscheint das jedem bekannte: „Ich selbst!“ Manchmal ist die Manifestation der Unabhängigkeit mit Negativismus und Sturheit verbunden. Alle diese Aktivitätserscheinungen spiegeln sich in der inneren Welt des Kindes wider: Das Kind handelt zunächst und erkennt sich dann in einer neuen Funktion.
Zu Beginn des Vorschulalters wird sich das Kind durch die Entwicklung der inneren Geisteswelt seiner selbst als „Ich“ bewusst. Durch die aktive „Erprobung“ der eigenen Stärken und Fähigkeiten, unter dem Einfluss der gesammelten Erfolgs- und Misserfolgserfahrungen im Prozess objektiv-praktischer Aktivitäten in der Kommunikation des Kindes mit Erwachsenen und Gleichaltrigen, kommt es zu einem intensiven Prozess der Individualitätsbildung . Sondern Beziehungen im Bereich der Innenwelt: zu „Ich“ und „Nicht-Ich“, also die Beziehung des Kindes zu sich selbst als Subjekt des Lebens einerseits und zum umgebenden sozialen Umfeld andererseits. Es ist bekannt, dass bereits ein kleines Kind in der Lage ist, seine Melancholie und seine inneren Impulse vor anderen zu verbergen. Da das Kind autonom und verschlossen ist, ist seine innere Welt offen für äußere Einflüsse.
Zu Beginn des mittleren Vorschulalters ist die Struktur der inneren Welt des Kindes bereits recht komplex. Es hat ein „Zentrum“ und eine „Peripherie“. Im Mittelpunkt steht das Wissen des Kindes über sich selbst als Subjekt, über Persönlichkeit und Selbstwertgefühl, die Einstellung zu den Menschen um es herum und zur objektiven Welt.
Die Gestaltung der inneren Welt eines Vorschulkindes erfolgt unter dem direkten Einfluss nahestehender Menschen und ist untrennbar mit seinem Selbstbewusstsein als „Ich“ verbunden. Und die Bildung des „Ich“-Bildes ist nicht nur ein Mechanismus zur Entwicklung der Vorstellungen des heranwachsenden Menschen über sich selbst, sondern auch eine Möglichkeit, auf der subjektiven Ebene jene für das Kind persönlich bedeutsamen Beziehungen zu fixieren – zu umgebenden Menschen, Dingen, Aktivitäten usw., die, wenn sie in der inneren Welt gefestigt werden, zu seinen Werten werden.
2.2 Merkmale der Selbstbildbildungbei einem Vorschulkind
Das Selbstbild eines Vorschulkindes mit einem hohen Maß an Konvention kann außerhalb seiner Einheit mit dem Selbstwertgefühl betrachtet werden. Einige Autoren argumentieren jedoch, dass das „Ich“-Bild eher eine Reihe beschreibender als bewertender Vorstellungen über sich selbst ist. Tatsächlich legt ein Kind möglicherweise keinen besonderen Wert auf irgendwelche Eigenschaften und Qualitäten, bis die „Autoritäten“ diesen Eigenschaften und Qualitäten Aufmerksamkeit schenken und sie wertschätzen. Angesichts des bewertenden Einflusses eines Erwachsenen beginnt das Kind, das, was zum Gegenstand der Bewertung geworden ist, zu schätzen oder sich dafür zu schämen. In diesem Fall werden bestimmte Eigenschaften für das Kind persönlich bedeutsam, die in direktem Zusammenhang mit seinem Selbstbild stehen.
Die Bestätigung, dass alle im Selbstbild des Kindes oder in seinem Selbstbild enthaltenen Eigenschaften entweder positiv oder negativ, aber nicht neutral sind, sind die Merkmale der Bildung des kognitiven Teils des Selbstbildes (d. h. des Selbstbildes) .
Beurteilungen von Erwachsenen haben nicht immer eindeutige Auswirkungen auf das Kind; die Entwicklung der Vorstellungen des Kindes über sich selbst hängt in erster Linie davon ab, wie andere es betrachten – nahestehende Erwachsene, Erzieher, Gleichaltrige. Wir glauben, dass bewertende Einflüsse anderer Menschen die Möglichkeit einer Transformation dieser bewertenden Einflüsse durch die eigene Aktivität des Kindes nicht nur nicht ausschließen, sondern diese im Gegenteil notwendigerweise voraussetzen.
Eines der wichtigsten Merkmale der Bildung der Vorstellungen eines Kindes über sich selbst ist nämlich: Ein Vorschulkind ist sehr abhängig von der Einstellung eines Erwachsenen zu sich selbst – seinen Meinungen, Einschätzungen, Aufmerksamkeit, Wohlwollen, Zuneigung, Unterstützung und der Einschätzung dieses Erwachsenen andere Kinder.
Neben den bewertenden Einflüssen von Erwachsenen sind Beziehungen zu Gleichaltrigen und über verschiedene Kanäle (Fernsehen, Fiktion) erhaltenes Wissen darüber, was ein Kind sein sollte, um als gut zu gelten, Faktoren, die das Selbstbild eines Kindes beeinflussen. Beim Aufbau eines Bildes von sich selbst nutzt das Kind in der Gesellschaft bestehende Standards, Vorstellungen davon, was komplex, schön und anerkannt ist – all das wird in der inneren Welt des Kindes auf unterschiedliche Weise (abhängig von der sozialen Entwicklungssituation) transformiert.
Für Kinder, selbst im höheren Vorschulalter, ist es schwierig, ihre Ähnlichkeiten mit Gleichaltrigen zu erkennen, insbesondere wenn es sich um persönliche Manifestationen handelt.
Das Selbstbild eines Vorschulkindes ist für ihn untrennbar mit den Merkmalen seines eigenen Verhaltens verbunden, die ihm dadurch bewusst sind, dass Erwachsene im Prozess der pädagogischen Beeinflussung auf ihn und Gleichaltrige auf sie achten Interaktion mit ihm. Daher ist die Schaffung von Bedingungen, unter denen sich Kinder von der moralischen Seite zeigen können, auch eine Voraussetzung für die Bildung eines positiven Selbstbildes, und zwar nicht eines illusorischen, sondern eines, das mit dem realen Verhalten des Kindes übereinstimmt. Die Aktivierung des Vergleichsprozesses mit Gleichaltrigen – und vor allem das Bewusstsein für deren moralische Verdienste – ist ein starker Anreiz für die Entwicklung der Reflexivität, der Vorstellungen des Kindes über sich selbst und seine damit verbundenen inneren Positionen: „was ich bin“ und „ was er ist“, „was ich aus der Sicht anderer bin“.
Die „psychische Isolation“ des Kindes als einzigartiges besonderes Wesen und seine Identifikation mit Gleichaltrigen bilden die Einheit zweier gegensätzlicher Prozesse, deren Funktionieren erst im Rahmen einer vom Lehrer gesteuerten realen Interaktion zwischen Kindern möglich wird. Folglich erhält das Kind „von außen“ eine Vorstellung von sich selbst, allerdings nur unter der Bedingung, dass es seine eigene Aktivität als Subjekt der Kommunikation und Aktivität demonstriert.
3. Beschreibung der Studie und Analyse der erzielten Ergebnisse
3.1 Forschungsmethoden und -techniken
Die Studie wurde auf Basis der Vorschuleinrichtung Nr. 369 durchgeführt. Die Stichprobe bestand aus 20 Kindern im Alter von 5-6 Jahren.
Unsere Forschung bestand aus drei Phasen.
1. Vorbereitend, umfasste die Auswahl von psychodiagnostischem Material (Werkzeugen), das dem von uns gewählten Problem entspricht und uns die Durchführung von Untersuchungen zum Thema, den Zielen und Zielsetzungen der Studie ermöglicht. Erstellung von Protokollformularen zur Sammlung empirischen Materials.
2. Die Hauptaufgabe bestand darin, einen Forschungsplan zu erstellen, der die Besonderheiten der Auswahl eines Blocks diagnostischer Techniken berücksichtigte. In dieser Phase wurde empirisches Material direkt planmäßig und auf der Grundlage der Ziele und Zielsetzungen der Arbeit gesammelt.
3. Abschließend fasste ich die Arbeit der beiden vorherigen Phasen der Studie unter Verwendung der Methode der quantitativen und qualitativen Analyse des gesammelten empirischen Materials zusammen.
In der ersten Phase der Studie wurden drei Diagnosetechniken ausgewählt:
Methodik „Untersuchung der Bildung des Bildes von „Ich““
Die „Leiter“-Technik zur Untersuchung der Vorstellungen eines Kindes über die Beziehungen anderer Menschen zu ihm
1. Um das Vorhandensein und die Art der Vorstellungen der Kinder über sich selbst zu ermitteln, wurde mit jedem von ihnen ein Gespräch geführt.
Die Kinder wurden gebeten, Fragen zu beantworten.
1. Wie heißt du?
2. Wie alt bist du?
3. Was bist du jetzt – groß oder klein? Warum denkst du so?
4. Warst du jemals klein?
5. Woher wissen Sie das?
6. Wie klein warst du? Erzählen Sie uns von Ihrem kleinen Ich (Was könnten Sie tun?).
7. Was können Sie jetzt tun?
8. Wie werden Sie Ihrer Meinung nach sein, wenn Sie etwas älter und wirklich groß werden?
9. Wer ist besser ein Erwachsener oder ein Kind? Warum?
Die Antworten der Kinder wurden im Protokoll festgehalten.
2. Die „Leiter“-Technik wurde von V.G. entwickelt. Shchur (eine modifizierte Version der Dembo-Rubinstein-Technik) und soll das Vorstellungssystem des Kindes darüber identifizieren, wie es sich selbst bewertet, wie andere Menschen es seiner Meinung nach bewerten und wie diese Ideen zueinander in Beziehung stehen.
Um diese Technik anzuwenden, müssen Sie das Material vorbereiten: ein Papier oder eine gezogene Leiter, eine Figur eines Mannes (vorzugsweise die Umrisse eines Jungen und eines Mädchens), ein Blatt Papier und einen Bleistift (Kugelschreiber).
Die Technik wird individuell durchgeführt. Sie sprechen beiläufig mit dem Kind über die Zusammensetzung seiner Familie, seiner nahen Verwandten, Freunde usw. Dann zeigt der Prüfer eine Leiter, auf der von der zentralen Plattform aus drei Stufen nach oben und drei nach unten führen (oder eine solche Leiter wird vom Experimentator auf ein Blatt Papier gezeichnet). Gleichzeitig erhält das Kind die Anweisung: „Schau dir diese Leiter an. Wenn alle Kinder auf den Stufen sitzen, sind die besten ganz oben; einen Schritt weiter unten – einfach gut; eine weitere Stufe tiefer – durchschnittlich, aber auch gut; noch niedriger – schlecht; Ganz unten sind die schlimmsten Kinder. Danach erhält das Kind eine Männerfigur (ein Junge oder ein Mädchen, je nach Geschlecht des Kindes) und es wird ihm gesagt:
Stellen Sie sich vor, Sie wären es. Auf welches Niveau würden Sie sich selbst einstufen? Warum?
Bist du wirklich so oder willst du so sein?
Welchen Schritt würde deine Mutter von dir verlangen?
Welcher – Papa?
Welches ist Oma?
Was ist mit dem Lehrer (Erzieher)?
In allen Fällen bittet der Psychologe das Kind, seine Wahl zu erklären.
Alle Antworten der Kinder werden im Protokoll festgehalten. Ein Gespräch mit einem Kind dauert etwa 10 Minuten.
Selbstwertgefühl ist die Einschätzung einer Person über sich selbst, ihre Fähigkeiten, Qualitäten und ihren Platz unter anderen Menschen. Dies ist der bedeutendste und am besten untersuchte Aspekt des Selbstbewusstseins einer Person in der Psychologie. Mit Hilfe des Selbstwertgefühls wird das Verhalten einer Person reguliert.
3.2 Ergebnisse der Untersuchung der Wahrnehmungen vonsich selbst bei Vorschulkindern
Wie oben erwähnt, umfasste die Stichprobe der Probanden 20 Kinder im Alter von 5 bis 6 Jahren aus der Vorschuleinrichtung Nr. 369. Die Forschungsergebnisse werden in zwei Tabellen dargestellt:
Lassen Sie uns diese Tabellen analysieren.
Die Analyse der Ergebnisse des Gesprächs mit Kindern ergab, dass alle Kinder im Alter von 5 bis 6 Jahren ihren vollständigen Namen kennen und wissen, wie alt sie sind.
95 % der Kinder halten sich für „groß“, nur 5 % für „klein“. Alle Kinder sind sich sicher, dass sie klein waren, aber erzählen Sie uns von Ihrem „kleinen“ Ich, wie sie waren in der Vergangenheit nicht jeder kann.
Auf die Frage: „Woher weißt du, dass du mal klein warst?“ Wir haben folgende Antworten gehört:
Ilya Ts. – „Ich habe die Bänder und Fotos gesehen.“
Nastya G. – „Ich bin nach und nach erwachsen geworden.“
Sergey S. – „Ich erinnere mich an alles, ich wurde im Herbst geboren.“
Die Mehrheit der Kinder (33,4 %) antwortete jedoch, dass sie dies von ihrer Mutter gelernt hätten.
Dasha M. – „Mama hat gesagt.“
Julia K. – „Ich erinnere mich, dass ich meine Mutter gefragt habe“
Auf die Bitte des Psychologen, mir zu sagen: „Wie klein waren Sie, was konnten Sie als kleines Kind tun?“ Kinder listen in der Regel die Haupteigenschaften von Babys auf.
Maxim B. – „Kriech, könnte quietschen.“
Vladik M. – „Ich konnte nicht laufen, dann habe ich es gelernt“;
Svetlana Z. – „Im Kinderwagen liegen.“
Anya S. – „Weinen“
Sowohl Mädchen als auch Jungen antworteten ungefähr gleich. So wurde die Vorstellung der meisten Kinder von ihrem kleinen Ich auf der Grundlage der Geschichten ihrer Mütter, Kinderfotos und Videoaufzeichnungen geformt.
Kinder im Alter von 5 bis 6 Jahren sind sich ihrer selbst bewusst gegenwärtig und auf die Frage: „Was können Sie jetzt tun?“ Antwort:
Alina G. – „Zeichne, singe“
Natasha K. – „Ich kann Salat und Brötchen machen“
Dima Ch. – „Ich kann alles. Helft Mama und Papa.“
Auf die Frage: „Was wirst du, wenn du erwachsen bist?“ Wir haben folgende Antworten gehört:
Vladik A. – „Ich werde Fahrer“
Maxim B. – „Ich werde in der Mine arbeiten“
Anya A. – „Ich werde wie eine große Mutter sein“
Kirill K. – „Ich werde Vater“
Ira P. – „Ich werde Mutter“
Dima D. – „Ich werde Onkel“
Die Analyse der Antworten der Kinder ergab, dass mehr als 63 % der Kinder im Alter von 5 bis 6 Jahren ein Bild haben zukünftiges „Ich“ mit dem Geschlecht des Kindes verbunden, d.h. Die Geschlechtsidentifikation gehört zum Bild der Zukunft.
81,5 % der Kinder im Vorschulalter sind sich sicher, dass es besser ist, ein Erwachsener zu sein als ein Kind.
Damit wurde die Tatsache bestätigt, dass im höheren Vorschulalter im Zusammenhang mit der Orientierung des Kindes an einem Erwachsenen und den Tendenzen in der Entwicklung des Selbstbewusstseins im Laufe der Zeit ein intensiver Prozess der Selbstwahrnehmung stattfindet. Das Bild von „Ich“ in der Zukunft umfasst alle primären Komponenten des Selbstbewusstseins: Veränderungen der körperlichen Erscheinung, des Geschlechts, Ansprüche auf Anerkennung.
Der Einsatz der „Leiter“-Technik zeigte, dass 86,9 % der Kinder sich auf die höchste Stufe der Leiter begaben.
Die Kinder gaben folgende Erklärung:
Julia K.: „Ich bin nicht schlecht“;
Anna S.: „Mir geht es sehr gut.“
Dasha M. antwortete: „Mir geht es gut, ich backe Strohhalme“;
Sergey S.: „Ich teile alles. Ich bin gehorsam“;
Ira P.: „Geschirr spülen.“
Dabei bereits 55 % der Kinder halten sich für „die Besten“.
Der Rest der Kinder glaubt, dass sie noch gut werden müssen. Dies weist darauf hin, dass im Bewusstsein von Kindern dieses Alters eine neue Komponente „Real Self“ und „Ideal Self“ aufgetaucht ist.
Nach Meinung des Kindes wird es daher von seiner Mutter am angemessensten beurteilt, von seiner Großmutter strenger und von der Kindergärtnerin am strengsten. Päpsten wird die „Rolle von Beschützern“ zugeschrieben.
Schlussfolgerungen
Basierend auf der geleisteten Arbeit können wir Folgendes sagen:
In den Köpfen von Vorschulkindern entsteht das „Ich-Bild“ und Vorschulkinder entwickeln eine Vorstellung von sich selbst.
Es wurde bestätigt, dass im höheren Vorschulalter mit der Zeit ein intensiver Prozess der Selbsterkenntnis im Selbstbewusstsein des Kindes stattfindet.
Das Kind erhält von Erwachsenen Wissen über sich selbst in der Vergangenheit (durch Befragung der Eltern, Ansehen von Fotos und Videobändern). Bei den meisten Kindern wurde ihre Vorstellung von ihrem kleinen Selbst auf der Grundlage der Geschichten ihrer Mutter geformt (33,4 %).
Mehr als 63 % der Kinder im Alter von 5 bis 6 Jahren, das Bild zukünftiges „Ich“ mit dem Geschlecht des Kindes verbunden, d.h. Die Geschlechtsidentifikation gehört zum Bild der Zukunft. Das Bild von „Ich“ in der Zukunft umfasst alle anderen primären Komponenten des Selbstbewusstseins: Veränderungen in der körperlichen Erscheinung, Ansprüche auf Anerkennung.
In den Köpfen von Kindern existiert die Vorstellung von sich selbst in Form von Bildern von „Ich-real“ – was ich bin und „Ich-ideal“ – was ich werden möchte. So glauben 55 % der Kinder, dass sie bereits „die Besten“ sind.
Die Besonderheit des Selbstwertgefühls von Vorschulkindern besteht darin, dass es äußere, klar wahrgenommene Eigenschaften und Qualitäten widerspiegelt.
Es wurde festgestellt, dass die Selbsteinschätzungen der Kinder stark mit den Einschätzungen der Eltern korrelieren. Dem Kind zufolge bewerten ihn seine Mutter und sein Vater am besten, seine Großmutter strenger und die Kindergärtnerin am strengsten. Dies bestätigt die allgemeinen Bestimmungen über den Zusammenhang des Bewusstseins mit der Sphäre der Kommunikation und Beziehungen, über die soziale Konditionierung des Bewusstseins.
Literatur
Psychologische Vorschule zur Selbsterkenntnis
1. Abramenkova V.V. Sozialpsychologie der Kindheit: Entwicklung kindlicher Beziehungen in der kindlichen Subkultur // Angewandte Psychologie. - 2003. - Nr. 5.
2. Abramova G.S. Altersbezogene Psychologie. - M., Akademie, 2003.
3. Abulkhanova-Slavskaya K.A. Aktivitäts- und Persönlichkeitspsychologie. - M.: Nauka, 2000.
4. Averin V.A. Psychologie von Kindern und Jugendlichen St. Petersburg: Verlag Mikhailov V.A., 1998.- 379 S.
5. Ananyev B.G. Zu den Problemen der modernen Humanwissenschaft. - M., 2000.
6. Antsyferova L.I. Zur Psychologie der Persönlichkeit als Entwicklungssystem. Psychologie der Persönlichkeitsbildung und -entwicklung. - M., 2001.
7. Arkhipova K.A. Selbstbildbildung bei Kindern // Fragen der Psychologie. - 1996. - Nr. 4.
8. Basova N.V. Pädagogik und praktische Psychologie – Rostoa n/D, „Phoenix“, 2000. – 416 S.
9. Belopolskaya N.L. Identifizierung von Geschlecht und Alter. Methodik zur Untersuchung des Selbstbewusstseins von Kindern., M., 2005.
10. Burns R. Entwicklung des Selbstverständnisses und der Bildung / Übers. aus dem Englischen - M., 1986.
11. Bodalev A.A. Wahrnehmung und Verständnis des Menschen durch den Menschen. M., 2002.
12. Bozhovich L.I. Persönlichkeit und ihre Bildung in der Kindheit. - M., 1968.
13. Bozhovich L.I. Stadien der Persönlichkeitsbildung in der Ontogenese // Fragen der Psychologie. - 1978, Nr. 4; 1979. - Nr. 2.
14. Vallon A. Charakterursprünge bei Kindern (Teil 3. Selbstbewusstsein.) – Frage. Psychology, 1990, Nr. 6, S. 121-133.
15. Vallon A. Geistige Entwicklung eines Kindes. M., 1967.
16. Vygotsky D.S. Sammlung Aufsätze. T. 4. M.: Pädagogik, 1984. S. 269--317.
17. Vygotsky L. S. Sammlung. Aufsätze. T. 2. M.: Pädagogik, 1982.P. 5-- 361.
18. Vygotsky L.S. Fragen der Kinderpsychologie. - St. Petersburg: Union, 1997.
19. Craig Craig Developmental Psychology – St. Petersburg, PETER, 2004 – 992 S.
20. Dimitrov I.T. Ganzheitliche Aktivität und „Selbstbild“ bei Vorschulkindern // Neue Forschungen in der Psychologie. - 2006. - Nr. 2.
21. Doltkazina E.N. Psychologische Probleme der emotionalen Entwicklung im Sozialisationsprozess von Vorschulkindern // Psychologie im Kindergarten. - 1999. - Nr. 2.
22. Ermolova T.V., Kolmogortseva I.S. Zeitlicher Aspekt des Selbstbildes bei älteren Vorschulkindern // Fragen der Psychologie. - 1995. Nr. 6, - S. 47-58
23. Schukowskaja R.I. Psychologie des menschlichen gegenseitigen Verständnisses. - K., 2005.
24. Zabrotsky M.M. Jahrhundertpsychologie. - K.: MAUP, 1998.
25. Zubova G.G. So bauen Sie Ihr „Ich“ auf. - M., 2001.
26. Wie kann man einem Kind den Einstieg in die moderne Welt erleichtern? /Hrsg. FERNSEHER. Antonova. - M., 2003.
27. Kozlova S.A. "Ich bin ein Mensch. Programm zur Einführung eines Kindes in die Gesellschaft. - M., 2003
29. Kon I.S. Auf der Suche nach sich selbst: Persönlichkeit und ihr Selbstbewusstsein. - M.: Nauka, 1984. - 335 S.
30. Kostyuk G.S. Ausgewählte psychologische Werke. - M.: Pädagogik, 1988.
31. Kulagina I.Yu. Entwicklungspsychologie: Entwicklung des Kindes von der Geburt bis zum siebzehnten Lebensjahr. - M.: Verlag ROU, 1998.
32. Kulagina I.Yu., Kolyutsky Ya.L. Entwicklungspsychologie: Der komplette Lebenszyklus der menschlichen Entwicklung – M.: TC „Sfera“, 2004 – 464 S.
33. Leontyev A.N. Aktivität, Bewusstsein, Persönlichkeit. - M., 2005.
34. Lisina M.I., Silvestru A.I. Psychologie des Selbstbewusstseins bei Vorschulkindern. - Chisinau, 1983. 205 S.
35. Persönlichkeit und Bewusstsein / Ed. A.A. Alekseeva - L.: Staatliche Universität Leningrad, 1989 - 183 S.
36. Maksimenko S.D. Entwicklung der Psyche in der Ontogenese. In 2 Bänden – K.: Forum, 2002
37. Mukhina V.S. Entwicklungspsychologie. - M.: ACADEMIA, 2000, 456 S.
38. Mukhina V.S. Kinderpsychologie. - M.: OOOApril Press, ZAO Verlag EKSMO-Press, 2001 - 352 S.
39. Myasishchev V. N. Bewusstsein als Einheit der Reflexion der Realität und der Einstellung einer Person dazu. / Problem des Bewusstseins, M., 1966.
40. Nepomnyashchaya T.I. Persönlichkeitsbildung eines 6-7-jährigen Kindes. - M., 2002.
41. Das „Ich“-Bild bei Vorschulkindern // Fragen der Psychologie. - 1995. - Nr. 2.
42. Obukhova L.F. Altersbezogene Psychologie. - M.: Verlag der Moskauer Staatlichen Universität, 2005.
43. Panteleev S.R. Selbsteinstellung als emotional-bewertendes System. - M.: Bildung, 1997. - 73 S.
44. Polivanova K.N. Psychologie altersbedingter Krisen - M.: ACADEMIA, 2000, 184 S.
45. Psychologische Diagnostik von Kindern und Jugendlichen. Ed. K.M. Gurewitsch, E. M. Borisova., M., 2000.
46. Entwicklung der Kommunikation zwischen Vorschulkindern und Gleichaltrigen. - M., 2005.
47. Entwicklung sozialer Emotionen bei Vorschulkindern / Ed. EIN V. Zaporozhets, Ya.Z. Neverovich. - M., 1996.
48. Rean A.A. Bordovskaya N.V. Rozum S.I. Psychologie und Pädagogik St. Petersburg: ZAO-Verlag „Peter“, 2000 – 432 S.
49. Rean A.A., Kolominsky Ya.L. Sozialpädagogische Psychologie – St. Petersburg, 2003 – 416 S.
50. Rubinshtein S.L. Probleme der allgemeinen Psychologie, M., 2005.
51. Rubinshtein S.L. Selbstbewusstsein des Einzelnen und seines Lebensweges // Sammlung. Werke: In 2 Bänden Band 2. M: 1989
52. Rybalko E.F. Entwicklungs- und Differentialpsychologie. - St. Petersburg, Verlag der Universität St. Petersburg, 2001 - 224 S.
53. Sidorenko E.V. Methoden der mathematischen Verarbeitung in der Psychologie., St. Petersburg, LLC „Rech“, 2002 -350.
54. Sokolova E. T. Projektive Methoden der Persönlichkeitsforschung. M., 2001.
55. Soziale Anpassung von Kindern in Vorschuleinrichtungen. Ed. R. V. Tonkova-Yampolskaya et al., M. 2006.
56. Spirkin A.G. Bewusstsein und Selbstbewusstsein. - M., 2004. 303 S.
57. Stolin V.V. Selbstbewusstsein des Einzelnen., M., 2006.
58. Persönlichkeitstheorien in der westeuropäischen und amerikanischen Psychologie – Samara: Verlag „Bakhrakh“, 2006 – 480 S.
59. Feldshtein D.I. Kindheit als sozialpsychologisches Phänomen und besonderer Entwicklungsstand // Fragen der Psychologie. - 2002. - Nr. 1.
60. Chamata P.R. Zur Frage der Genese des individuellen Selbstbewusstseins. - M., 1998.
61. Tschesnokova I.I. Das Problem des Selbstbewusstseins in der Psychologie. M., 1977.
62. Tschesnokova I.I. Merkmale der Entwicklung des Selbstbewusstseins in der Ontogenese. / Das Prinzip der Entwicklung in der Psychologie., M., 2003.
63. Elkonin D.B. Ausgewählte psychologische Werke. M.: Pädagogik, 1995.
64. Yakobson S.G. Psychologische Probleme der kindlichen Entwicklung. - M., 2005.
Gepostet auf Allbest.ru
Ähnliche Dokumente
Theoretische Analyse des Selbstwertgefühls eines Vorschulkindes als Subjekt der Selbstwahrnehmung in der Psychologie. Erforschung und Bestimmung des Selbstwertgefühls bei Kindern im höheren Vorschulalter. Der Inhalt einer psychologischen Methodik zur Identifizierung der Merkmale des Selbstwertgefühls bei Vorschulkindern.
Kursarbeit, hinzugefügt am 18.03.2011
Merkmale psychischer Zustände und Merkmale der Bildung des individuellen Selbstbewusstseins. Selbstwertgefühl als emotionaler Bestandteil des Selbstbewusstseins eines Vorschulkindes. Eine empirische Untersuchung der emotionalen Einstellung moderner Vorschulkinder zu sich selbst.
Kursarbeit, hinzugefügt am 30.12.2014
Dissertation, hinzugefügt am 15.09.2014
Bildung von Voraussetzungen für das ethnische Selbstbewusstsein von Kindern im höheren Vorschulalter im Rahmen organisierter psychologischer und pädagogischer Aktivitäten. Untersuchung der Bildung des Selbstbildes und des Selbstwertgefühls von Kindern anhand nicht-situativer persönlicher Gespräche.
Dissertation, hinzugefügt am 15.01.2014
Das Wesen und die Entstehung des Selbstbewusstseins. Merkmale seiner Entwicklung bei Kindern vom frühen Alter bis zur Vorschulzeit. Der Einfluss von Erwachsenen auf die Persönlichkeitsbildung eines Vorschulkindes. Forschungsergebnisse und eine Reihe von Techniken zur Diagnose der Strukturen des Selbstbewusstseins.
Dissertation, hinzugefügt am 14.05.2014
Theoretische Ansätze zum Problem der Entwicklung des Selbstwertgefühls in der ausländischen und inländischen Wissenschaft. Das Konzept des Selbstwertgefühls, sein Wesen und seine Arten. Merkmale der Entwicklung des Selbstwertgefühls bei Vorschulkindern. Psychologische Struktur des Selbstbewusstseins im Ansatz von I.S. Kona.
Kursarbeit, hinzugefügt am 08.12.2010
Definition von Selbstbewusstsein. Tätigkeitsarten nach V.V. Stolin. Psychologische Geschlechtserwerb. Beherrschung der Standards der Erbschuld. Merkmale des Grundschulalters. Entwicklung des Selbstbewusstseins im Grundschulalter und Indikatoren des Selbstwertgefühls.
Kursarbeit, hinzugefügt am 12.04.2014
Theoretische Grundlagen für die Untersuchung der persönlichen Sphäre von Vorschulkindern mit geistiger Behinderung, Merkmale des Selbstwertgefühls von Kindern. Methoden zur Untersuchung des Selbstbewusstseins, der Geschlechts- und Altersidentifikation, der Selbstkontrolle, des Selbstwertgefühls und der Angst von Kindern.
Dissertation, hinzugefügt am 30.12.2011
Einführung eines Programms, das die Schaffung psychologischer und pädagogischer Bedingungen umfasst, unter denen die Bildung des Selbstbewusstseins bei Kindern im höheren Vorschulalter stattfindet. Ermittlung des allgemeinen Niveaus der sozialen Anpassung eines Kindes in einer vorschulischen Bildungseinrichtung.
Kursarbeit, hinzugefügt am 28.09.2015
Selbstbewusstsein in der in- und ausländischen Psychologie. Selbstbewusstsein: Definition, Struktur und Ausbildungsbedingungen. Psychologische und altersbedingte Merkmale von Kindern im höheren Vorschulalter. Bildung des Selbstbewusstseins bei Vorschulkindern.
Einführung
Das Problem der Selbstwahrnehmung ist eines der schwierigsten in der Psychologie. Der effektivste Weg, dies zu untersuchen, besteht darin, die Entstehung des Selbstbewusstseins zu untersuchen, das hauptsächlich unter dem Einfluss von zwei Hauptfaktoren entsteht – den eigenen praktischen Aktivitäten des Kindes und seinen Beziehungen zu anderen Menschen.
Im Vorschulalter gilt die Entstehung des Selbstbewusstseins als wichtigste Errungenschaft der Persönlichkeitsentwicklung. Daher ist die Bestimmung der psychologischen Bedingungen für die Bildung des Selbstbewusstseins und die Identifizierung der Hauptursachen für unerwünschte Abweichungen in seiner Entwicklung von besonderer Bedeutung für den korrekten Aufbau der Grundlagen der zukünftigen Persönlichkeit des Kindes. Das Problem der Selbstwahrnehmung wird im Rahmen der in- und ausländischen psychologischen Forschung vielfach diskutiert. Das Studium der Struktur des Selbstbewusstseins und der Dynamik seiner Entwicklung ist sowohl theoretisch als auch praktisch von großem Interesse, da es uns ermöglicht, den Mechanismen der Persönlichkeitsbildung in der Ontogenese näher zu kommen. Das Problem des Selbstbewusstseins (Ich-Ich, Ich-Bild, Ich-Konzept) ist derzeit durchaus relevant. Dies liegt an der Notwendigkeit, den Grad der Bedeutung eines Kindes unter modernen Bedingungen sowie seine Fähigkeit zu bestimmen, sich selbst und die Welt um es herum zu verändern.
Selbstwertgefühl kann nicht von alleine, aus dem Nichts entstehen. Es besteht aus den Kommentaren von Erwachsenen, dem Familienklima, der Beziehung zwischen den Eltern, ihren Urteilen über die Charaktereigenschaften und Handlungen des Kindes. Erwachsene beeinflussen die Persönlichkeitsbildung eines Kindes, die Bildung seines Selbstwertgefühls und die Definition seines persönlichen „Ich“.
1. Das Konzept des „Selbstbewusstseins“ und seine Struktur
Selbstbewusstsein ist eine bestimmte Form eines realen Phänomens – Bewusstsein. Selbstbewusstsein setzt die Isolation und Trennung eines Menschen von sich selbst, seinem Ich, von allem, was ihn umgibt, voraus. Selbstbewusstsein ist das Bewusstsein einer Person für ihre Handlungen, Gefühle, Gedanken, Verhaltensmotive, Interessen und ihre Stellung in der Gesellschaft. Bei der Bildung des Selbstbewusstseins spielen die Empfindungen eines Menschen über seinen eigenen Körper, seine Bewegungen und Handlungen eine wichtige Rolle.
Selbstbewusstsein ist auf sich selbst gerichtetes Bewusstsein: Es ist Bewusstsein, das Bewusstsein zu seinem Subjekt, seinem Objekt macht. Wie ist dies aus Sicht der materialistischen Erkenntnistheorie möglich – das ist die zentrale philosophische Frage des Problems des Selbstbewusstseins. Die Frage besteht darin, die Besonderheiten dieser Form des Bewusstseins und der Erkenntnis zu klären. Diese Spezifität wird durch die Tatsache bestimmt, dass sich das menschliche Bewusstsein als subjektive Form der Realität im Akt des Selbstbewusstseins in Subjekt und Objekt, in wissendes Bewusstsein (Subjekt) und bekanntes Bewusstsein (Objekt) spaltet. Eine solche Spaltung ist eine offensichtliche und ständig beobachtete Tatsache, egal wie seltsam sie dem gewöhnlichen Denken erscheinen mag.
Das Problem des Selbstbewusstseins wurde erstmals von L.S. gestellt. Wygotski. Er verstand Selbstbewusstsein als eine genetisch höhere Form des Bewusstseins, als eine Stufe der Bewusstseinsentwicklung, die durch die Entwicklung der Sprache, willkürlicher Bewegungen und das Wachstum der Unabhängigkeit vorbereitet wird. EIN. Leontyev glaubte im Hinblick auf das Selbstbewusstsein, dass man bei der Wahrnehmung einer Person über sich selbst als Individuum zwischen Wissen über sich selbst und Bewusstsein über sich selbst unterscheiden muss. A.G. Spirkin versteht Selbstbewusstsein als das Bewusstsein und die Einschätzung einer Person über ihre Handlungen, ihre Ergebnisse, Gedanken, Gefühle, moralischen Charakter und Interessen, Ideale und Verhaltensmotive, eine ganzheitliche Einschätzung ihrer selbst und ihres Platzes im Leben. I.I. Chesnokova glaubt, dass es bei der Untersuchung des Problems des Selbstbewusstseins wichtig ist, die Beziehung zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein zu klären. Sie ist davon überzeugt, dass es sich um Phänomene einer Ordnung handelt, deren Trennung nur in der Abstraktion möglich ist, weil sie im wirklichen Leben eines Individuums vereint sind: In den Bewusstseinsprozessen ist Selbstbewusstsein in Form von Bewusstsein vorhanden die Zuordnung des Bewusstseinsakts zu meinem Selbst. Der Unterschied zwischen diesen Phänomenen besteht darin, dass, wenn das Bewusstsein auf die gesamte objektive Welt ausgerichtet ist, das Objekt des Selbstbewusstseins die Persönlichkeit selbst ist. Im Selbstbewusstsein fungiert sie sowohl als Subjekt als auch als Objekt des Wissens. Chesnokova gibt die folgende Definition von Selbstbewusstsein: „Selbstbewusstsein ist ein komplexer mentaler Prozess, dessen Kern darin besteht, dass eine Person zahlreiche Bilder von sich selbst in verschiedenen Aktivitäts- und Verhaltenssituationen in allen Formen der Interaktion mit wahrnimmt.“ anderen Menschen und in der Kombination dieser Bilder zu einer einzigen ganzheitlichen Formation – zu einer Darstellung und dann zum Konzept des eigenen Selbst als einem von anderen Subjekten unterschiedenen Subjekt; Bildung eines perfekten, tiefen und angemessenen Selbstbildes.“
In der Psychologie gibt es unterschiedliche Meinungen über die Komponenten, aus denen die Struktur des Selbstbewusstseins besteht. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Konzept von V.S. Muchina. Der zentrale Mechanismus zur Strukturierung des Selbstbewusstseins ist die Identifikation. In der Ontogenese der Persönlichkeit führt die Beherrschung der Identifikation als die Fähigkeit, die eigenen Eigenschaften, Neigungen, Gefühle anderen und die Eigenschaften, Neigungen, Gefühle anderer zuzuschreiben und als die eigenen zu erleben, zur Bildung von Mechanismen des Sozialverhaltens, zur Etablierung von Beziehungen zu einer anderen Person auf einer positiven emotionalen Basis. Die Zuordnung der Struktur des Selbstbewusstseins erfolgt durch den Mechanismus der Identifikation mit einem Namen, mit besonderen Mustern, die Anerkennungsansprüche entwickeln, mit Geschlecht, mit dem Bild von „Ich“ in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mit diesen soziale Werte, die die Existenz des Einzelnen im sozialen Raum sichern. Die Wiedergeburt der Persönlichkeit ist mit der Bildung einer Weltanschauung, mit dem Aufbau eines kohärenten Systems persönlicher Bedeutungen verbunden. Hier wirkt der Identifikationsmechanismus auf emotionaler und kognitiver Ebene. Eine entwickelte Persönlichkeit lässt sich von Ideologie und Weltanschauung leiten und prognostiziert sich selbst in die Zukunft, bildet sich ein Idealbild ihrer Lebensposition, identifiziert sich emotional und rational damit und strebt danach, diesem Bild zu entsprechen.
V.V. Stolin versteht unter Identität das Selbstbewusstsein einer Person, das eine vielschichtige Struktur aufweist und die Identifizierung des Individuums mit seiner sozialen Integrität, Einzigartigkeit und Bedeutung seines Wesens sowie die Bildung und Veränderung von Vorstellungen über seine Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart umfasst. Er betrachtet den Menschen als Subjekt der Aktivität, das seine Aktivität auf verschiedenen Ebenen manifestiert, und glaubt, dass so wie im Lebensprozess eines Organismus ein Körperdiagramm entsteht, so bildet sich auch das Individuum ein Bild von sich selbst (phänomenologisches Selbst), das diesem angemessen ist sein soziales und aktives Dasein. „Der Prozess der Entwicklung des Subjekts selbst, betrachtet unter dem Gesichtspunkt der Entstehung seines phänomenalen Selbst, das wichtige Funktionen in der Aktivität des Subjekts hat, ist der Prozess der Entwicklung seines Selbstbewusstseins.“ Er korreliert die Prozesse des Selbstbewusstseins mit den Aktivitätsebenen eines Menschen als Organismus, Individuum und Persönlichkeit und identifiziert drei Ebenen des Selbstbewusstseins:
I - „...Selbstselektion und Selbstberücksichtigung (in motorischen Handlungen)“; Selbstbewusstsein, Identität, Selbstwertgefühl von Vorschulkindern
II – das Selbstbewusstsein des Einzelnen, d. h. Akzeptanz der Sichtweise eines anderen auf sich selbst, Identifikation mit den Eltern, mit Rollen, Bildung von Selbstbeherrschung;
III – individuelles Selbstbewusstsein als Identifizierung des eigenen sozialen Wertes und der Bedeutung des Seins, Bildung einer Vorstellung von der eigenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Basierend auf einem solchen mehrstufigen Modell des Selbstbewusstseins, das über die Idee von A.N. nachdenkt. Leontyev über persönliche Bedeutung, V.V. Stolin kommt auf die Idee der Existenz einer Einheit des Selbstbewusstseins – der „Bedeutung des Selbst“, die teilweise mit dem Selbstwertgefühl identisch ist und eine adaptive Funktion in Bezug auf die Aktivität des Subjekts erfüllt. V.V. Stolin glaubt, dass die „Bedeutung des Selbst“ als Beziehung zum Motiv oder Ziel der für ihre Erreichung relevanten Qualitäten des Subjekts erzeugt und im Selbstbewusstsein in Bedeutungen (kognitive Konstrukte) und emotionale Erfahrungen geformt wird. Folglich basiert das Selbstbewusstsein einer Person auf der Lösung innerer Widersprüche, die durch die Realität erzeugt werden, was den dialogischen Charakter des Selbstbewusstseins des Einzelnen bestimmt. Im Prozess zahlreicher interner Dialoge entsteht ein „Bild des Selbst“, wie V.V. Stolin: „Das Selbstbild ist ein Produkt des Selbstbewusstseins.“
Ansichten von V.V. Stolin steht den Gedanken von I.S. nahe. Kona. Nach Ansicht von I.S. Konas Identität (Selbst) ist einer der Aspekte des „Ich“-Problems – „Ego“ (Subjektivität) und „Ich-Bild“. „Ego“ als Regulierungsmechanismus setzt die Kontinuität der geistigen Aktivität und das Vorhandensein von Informationen über sich selbst voraus. Das „Selbstbild“ wird gewissermaßen vervollständigt und zugleich korrigiert. Das Problem des menschlichen Selbst zieht sich wie ein roter Faden durch sein gesamtes Werk. IST. Cohn bemerkt: „Die Reihe mentaler Prozesse, durch die ein Individuum sich selbst als Subjekt einer Aktivität erkennt, wird Selbstbewusstsein genannt, und seine Vorstellungen von sich selbst entwickeln sich zu einem bestimmten „Bild des Selbst“. Laut I.S. Konu, das „Bild des Selbst“ ist das Einstellungssystem der Persönlichkeit, einschließlich der Einstellung zu sich selbst; Bewusstsein und Selbstwertgefühl der eigenen individuellen Eigenschaften und Qualitäten; körperliche Merkmale (Wahrnehmung und Beschreibung des eigenen Körpers und Aussehens). Somit ist das „Bild des Selbst“ die Gesamtheit der Vorstellungen eines Individuums über sich selbst.
M.I. Lisina erforscht die Natur der Kommunikation und kommt zu dem Schluss, dass sich in der Kommunikation ein Selbstbild bildet. Es handelt sich um ein affektiv-kognitives Bild, das Einstellungen zu sich selbst (Selbstwertgefühl) und zum Selbstbild umfasst. Laut M.I. Lisina, die Merkmale des Selbstbildes sind zweitrangig, Subjektivität und Verbindung mit der Aktivität des Individuums, das es erzeugt, Selektivität der Reflexion des Originals darin, Dynamik und Variabilität des Bildes, komplexe Architektur der Struktur, komplexe Verbindung mit Die Prozesse des Bewusstseins. M.I. Lisina glaubt, dass die Vorstellung von sich selbst in der Wahrnehmung entsteht, dann wird das Bild der Wahrnehmung im Gedächtnis verarbeitet, angereichert durch visuelles Denken und sogar rein spekulative Schemata. Die Struktur des Selbstbildes besteht aus einem Kern, der Wissen über sich selbst als Subjekt und Persönlichkeit, das allgemeine Selbstwertgefühl enthält, und der Peripherie, in der neues Wissen über sich selbst, spezifische Fakten und privates Wissen angesammelt werden. Die Peripherie wird durch das Prisma des Kerns gebrochen und mit affektiven Komponenten überwuchert. Das Selbstbild ist dynamisch und entwickelt sich ständig weiter. Es verändert sich nicht im Detail, sondern wird qualitativ völlig verändert. M.I. Lisina identifiziert zwei Hauptquellen für die Konstruktion des Selbstbildes:
I - Erfahrung individueller menschlicher Aktivität;
II – Erfahrung in der Kommunikation mit anderen Menschen.
Folglich können wir sagen, dass sich in der Psychologie im allgemeinsten Sinne eine eigentümliche Trias in Bezug auf das Verständnis von Identität entwickelt hat: Bewusstsein – Selbstbewusstsein – Selbstbild Identität kann als Äquivalent von Selbstbewusstsein betrachtet werden. wobei Selbstbewusstsein als eine Reihe mentaler Prozesse verstanden wird, deren Vereinigung, durch die sich eine Person ihrer selbst bewusst wird. Durch das Bewusstsein erhält ein Mensch Vorstellungen über sich selbst, und das ganzheitliche System aller Vorstellungen ist das Selbstbild des Einzelnen. Das Selbstbild ist ein Produkt der Selbstwahrnehmung, einschließlich kognitiver, emotionaler und verhaltensbezogener Komponenten.
. Entwicklung des „Ich“-Bildes bei Vorschulkindern
Eines der vorrangigen Ziele der Vorschulerziehung ist derzeit die Bildung einer ganzheitlichen, harmonischen Persönlichkeit eines Vorschulkindes. Die Lösung dieses Problems ist unter den Bedingungen eines ganzheitlichen pädagogischen Prozesses produktiv, der nicht nur auf die intellektuelle, moralische, ästhetische und körperliche Entwicklung abzielt, sondern auch auf die Kenntnis des Kindes über sein eigenes spirituelles Potenzial, sein persönliches Wesen.
Bisher hat die Pädagogik dem Prozess der Bildung des Ich-Bildes eines Kindes nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Basierend auf der Forschung von M.V. Korepanova, unter dem Bild „Ich“ verstehen wir die Gesamtheit der sich entwickelnden Vorstellungen eines Kindes über sich selbst, die mit seinem Selbstwertgefühl verbunden sind und die Wahl der Art und Weise der Interaktion mit der Gesellschaft bestimmen.
Bei der Untersuchung der Merkmale der Bildung des „Ich“-Bildes ist es notwendig, die Sensibilität der Zeit der Vorschulkindheit und ihren Einfluss auf die Art der Interaktion des Kindes mit Gleichaltrigen zu berücksichtigen.
Moderne Forschungsmaterialien zeigen, dass die Vorstellungen eines Kindes über sich selbst und seine Einstellung zu sich selbst nicht angeboren sind, sondern im Laufe der Kommunikation entstehen. Die Bildung des „Ich“-Bildes eines Kindes hängt vollständig von den Informationen ab, die ihm seine unmittelbare Umgebung liefert: die Welt der Erwachsenen und die Welt der Gleichaltrigen.
Im Vorschulalter werden die Vorstellungen eines Kindes über sich selbst in Korrelation mit den Bildern anderer Kinder geformt. Es besteht eine enge Verflechtung zwischen der Erfahrung individueller Aktivität und der Erfahrung der Kommunikation. Das Kind beobachtet andere Kinder neugierig, vergleicht eifersüchtig ihre Leistungen mit seinen eigenen und bespricht mit Interesse seine eigenen Angelegenheiten und die seiner Kameraden mit den Älteren. Allmählich nimmt die Bedeutung der Kommunikation mit Spielpartnern so stark zu, dass es möglich ist, den Prozess der Kommunikation eines Kindes mit Gleichaltrigen als einen der führenden Faktoren für die Entwicklung der Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins hervorzuheben, insbesondere in den ersten sieben Jahren das Leben eines Kindes. Kontakte mit Gleichaltrigen bereichern die Selbsterkenntniserfahrung des Kindes erheblich und vertiefen seine Einstellung zu sich selbst als Handlungssubjekt. Deshalb haben wir uns der Untersuchung des Wesens und der Muster dieses Prozesses zugewandt. Zu diesem Zweck wurde ein Modell des Prozesses der schrittweisen Bildung des „Ich“-Bildes von Vorschulkindern in der Kommunikation mit Gleichaltrigen entwickelt.
Die erste Phase war der Selbsterkenntnis durch gemeinsame Spiele und Aktivitäten mit Gleichaltrigen gewidmet, die sich in der Präsenz und Art der Vorstellungen über sich selbst und andere ausdrückten. Für ein Kind ist es wichtig zu verstehen, wie ähnlich es seinen Mitmenschen ist, wie sich diese Ähnlichkeit äußert und ob es gut ist, wie die Kinder um es herum zu sein.
Die zweite Stufe zielt darauf ab, durch die Überwindung der Widersprüche zwischen positiver Selbstdarstellung und Beurteilung durch Gleichaltrige eine angemessene Selbstwahrnehmung des Kindes zu entwickeln. Wir glauben, dass ein ganzheitliches Selbstbild nur dann entstehen kann, wenn das Kind lernt, auf seine eigenen Gefühle zu hören und über seine Gefühle und Erfahrungen zu sprechen. Für einen Vorschulkind ist es immer noch schwierig, den engen Zusammenhang zwischen den erlebten Zuständen zu verstehen: Schmerzen lösen in ihm negative Gefühle aus und etwas zu tun, das er liebt, hebt seine Stimmung. Spiele und Trainingsübungen helfen, die innere Welt von Gefühlen und Zuständen zu verstehen, sie zu analysieren und zu verwalten. Die Fähigkeit, seine Gefühle zu reflektieren, ermutigt das Kind, auf die Wünsche anderer Rücksicht zu nehmen und sein Verhalten an allgemein anerkannte Regeln anzupassen.
Die dritte Phase war einem Prozess gewidmet, bei dem Vorschulkinder ihr „Ich“ identifizieren und sich mit anderen vergleichen sollten, um einen würdigen Platz in verschiedenen sozialen Beziehungen zu finden. Die Arbeit vorschulischer Bildungseinrichtungen in dieser Phase besteht darin, Vorschulkindern ein neues Maß an Selbstbewusstsein zu vermitteln, das sich in einem ganzheitlichen, wahren Selbstverständnis und der Akzeptanz von sich selbst als einzigartigem, einzigartigem Individuum ausdrückt.
Daher ist das Bewusstsein des Kindes für sein „Ich“ ein entscheidender Moment in der ganzheitlichen Entwicklung der Persönlichkeit des Vorschulkindes. Es erscheint notwendig, die Erfahrungen der Selbsterkenntnis von Vorschulkindern in die Inhalte der Vorschulerziehung einzubeziehen, die zur Entwicklung der Selbstständigkeit, des Selbstvertrauens der Kinder und der Ergebnisse ihrer Aktivitäten im Spielraum der Kindergemeinschaft beitragen.
3. Merkmale des Selbstwertgefühls im Vorschulalter. Die Rolle von Erwachsenen bei der Gestaltung des Selbstwertgefühls eines Kindes
Im Vorschulalter sind Beurteilung und Selbstwertgefühl emotionaler Natur. Von den umliegenden Erwachsenen werden diejenigen am positivsten bewertet, für die das Kind Liebe, Vertrauen und Zuneigung empfindet. Ältere Kinder im Vorschulalter bewerten häufiger die Innenwelt der Erwachsenen um sie herum und können so eine tiefere und differenziertere Einschätzung erhalten als Kinder im mittleren und jüngeren Vorschulalter.
Ein Vergleich des Selbstwertgefühls eines Vorschulkindes bei verschiedenen Arten von Aktivitäten zeigt einen ungleichen Grad seiner Objektivität („Überschätzung“, „ausreichende Einschätzung“, „Unterschätzung“). Die Richtigkeit des Selbstwertgefühls von Kindern wird maßgeblich von den Besonderheiten der Aktivität, der Sichtbarkeit ihrer Ergebnisse, dem Wissen über ihre Fähigkeiten und Erfahrungen bei deren Bewertung, dem Grad der Aneignung echter Bewertungskriterien in diesem Bereich und dem Niveau der die Wünsche des Kindes in einer bestimmten Aktivität. Daher ist es für Kinder einfacher, eine angemessene Selbsteinschätzung der von ihnen angefertigten Zeichnung zu einem bestimmten Thema abzugeben, als ihre Position im System persönlicher Beziehungen richtig einzuschätzen.
Während der gesamten Vorschulkindheit bleibt ein allgemein positives Selbstwertgefühl erhalten, das auf der selbstlosen Liebe und Fürsorge seitens nahestehender Erwachsener basiert. Dies trägt dazu bei, dass Kinder im Vorschulalter dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu überschätzen. Die Erweiterung der Tätigkeitsarten, die das Kind beherrscht, führt zur Bildung eines klaren und selbstbewussten spezifischen Selbstwertgefühls, das seine Einstellung zum Erfolg einer bestimmten Handlung zum Ausdruck bringt.
Charakteristisch ist, dass das Kind in diesem Alter sein eigenes Selbstwertgefühl von der Selbsteinschätzung anderer trennt. Das Wissen eines Vorschulkindes um die Grenzen seiner Kräfte beruht nicht nur auf der Kommunikation mit Erwachsenen, sondern auch auf seiner eigenen praktischen Erfahrung. Kinder mit überhöhten oder unterschätzten Vorstellungen von sich selbst reagieren empfindlicher auf die bewertenden Einflüsse von Erwachsenen und lassen sich leichter von ihnen beeinflussen .
Im Alter von drei bis sieben Jahren spielt die Kommunikation mit Gleichaltrigen eine wichtige Rolle im Prozess der Selbsterkenntnis eines Vorschulkindes. Ein Erwachsener ist ein unerreichbarer Maßstab, und Sie können sich mit Gleichaltrigen auf Augenhöhe vergleichen. Beim Austausch bewertender Einflüsse entsteht eine bestimmte Haltung gegenüber anderen Kindern und gleichzeitig entwickelt sich die Fähigkeit, sich selbst durch deren Augen zu sehen. Die Fähigkeit eines Kindes, die Ergebnisse seiner eigenen Aktivitäten zu analysieren, hängt direkt von seiner Fähigkeit ab, die Ergebnisse anderer Kinder zu analysieren. So entwickelt sich in der Kommunikation mit Gleichaltrigen die Fähigkeit, eine andere Person einzuschätzen, was die Entwicklung eines relativen Selbstwertgefühls anregt. Es drückt die Einstellung des Kindes zu sich selbst im Vergleich zu anderen Menschen aus.
Je jünger die Kinder im Vorschulalter sind, desto weniger aussagekräftig sind die Beurteilungen durch Gleichaltrige für sie. Im Alter von drei oder vier Jahren sind die gegenseitigen Einschätzungen der Kinder subjektiver und werden häufiger von ihrer emotionalen Einstellung zueinander beeinflusst. In diesem Alter überschätzt das Kind seine Leistungsfähigkeit, weiß wenig über persönliche Qualitäten und kognitive Fähigkeiten und verwechselt oft konkrete Leistungen mit einer hohen persönlichen Einschätzung. Aufgrund der entwickelten Kommunikationserfahrung im Alter von fünf Jahren kennt das Kind nicht nur seine Fähigkeiten, sondern hat auch eine Vorstellung von seinen kognitiven Fähigkeiten, persönlichen Qualitäten und seinem Aussehen und reagiert angemessen auf Erfolg und Misserfolg. Mit sechs oder sieben Jahren hat ein Vorschulkind eine gute Vorstellung von seinen körperlichen Fähigkeiten, schätzt diese richtig ein und entwickelt eine Vorstellung von seinen persönlichen Qualitäten und geistigen Fähigkeiten. Kinder sind kaum in der Lage, die Handlungen ihrer Kameraden in verschiedenen Situationen zu verallgemeinern und unterscheiden nicht zwischen inhaltlich ähnlichen Eigenschaften. Im frühen Vorschulalter sind positive und negative Peer-Bewertungen gleichmäßig verteilt. Bei älteren Vorschulkindern überwiegen positive Einschätzungen. Kinder im Alter von 4,5 bis 5,5 Jahren sind am anfälligsten für Beurteilungen durch Gleichaltrige. Die Fähigkeit, sich mit Freunden zu vergleichen, erreicht bei Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren ein sehr hohes Niveau. Bei älteren Vorschulkindern hilft die reichhaltige Erfahrung individueller Aktivitäten dabei, den Einfluss von Gleichaltrigen kritisch zu bewerten.
Mit zunehmendem Alter wird das Selbstwertgefühl immer korrekter und spiegelt die Fähigkeiten des Kindes besser wider. Zunächst tritt es bei produktiven Aktivitäten und bei Spielen mit Regeln auf, bei denen Sie Ihr Ergebnis klar sehen und mit dem Ergebnis anderer Kinder vergleichen können. Mit echter Unterstützung: einer Zeichnung, einem Entwurf fällt es Vorschulkindern leichter, sich selbst eine richtige Einschätzung zu geben.
Allmählich steigt die Fähigkeit von Vorschulkindern, das Selbstwertgefühl zu motivieren, und auch der Inhalt der Motivationen ändert sich. Eine Studie von T. A. Repina zeigt, dass bei Kindern im Alter von drei bis vier Jahren die Tendenz besteht, ihre Werthaltung gegenüber sich selbst eher auf ästhetischen als auf ethischen Reizen zu gründen („Ich mag mich selbst, weil ich schön bin“).
Vier- bis fünfjährige Kinder assoziieren Selbstwertgefühl vor allem nicht mit der eigenen Erfahrung, sondern mit der wertenden Haltung anderer: „Ich bin gut, weil der Lehrer mich lobt.“ In diesem Alter besteht der Wunsch, etwas an sich selbst zu verändern, obwohl dies nicht die moralischen Charaktereigenschaften betrifft.
Im Alter von 5 bis 7 Jahren rechtfertigen sie ihre positiven Eigenschaften unter dem Gesichtspunkt des Vorhandenseins moralischer Qualitäten. Aber selbst mit sechs oder sieben Jahren können nicht alle Kinder ihr Selbstwertgefühl motivieren. Im siebten Lebensjahr beginnt das Kind, zwei Aspekte des Selbstbewusstseins zu unterscheiden – Selbsterkenntnis und Einstellung zu sich selbst. So beobachtet man beim Selbstwertgefühl: „Manchmal gut, mal schlecht“ eine emotional positive Einstellung sich selbst gegenüber („Ich mag mich“) oder bei einer allgemein positiven Einschätzung: „Gut“ eine verhaltene Einstellung („Ich mag mich“) ein wenig“) beobachtet wird. Im höheren Vorschulalter steigt neben der Zufriedenheit der meisten Kinder mit sich selbst auch der Wunsch, etwas an sich zu verändern, anders zu werden.
Im Alter von sieben Jahren vollzieht sich bei einem Kind eine wichtige Veränderung seines Selbstwertgefühls. Es geht vom Allgemeinen zum Differenzierten. Das Kind zieht Rückschlüsse auf seine Leistungen: Es merkt, dass es manche Dinge besser meistert, andere schlechter. Vor dem fünften Lebensjahr überschätzen Kinder meist ihre Fähigkeiten. Und mit 6,5 Jahren loben sie sich selbst selten, obwohl die Tendenz zur Prahlerei bestehen bleibt. Gleichzeitig nimmt die Zahl der fundierten Schätzungen zu. Mit 7 Jahren schätzen die meisten Kinder sich selbst richtig ein und sind sich ihrer Fähigkeiten und Erfolge bei verschiedenen Aktivitäten bewusst.
Ältere Vorschulkinder erkennen nicht nur ihre Qualitäten, sondern versuchen auch, die Motive ihres eigenen Handelns und des Handelns anderer zu verstehen. Sie beginnen, ihr eigenes Verhalten zu erklären und stützen sich dabei auf das Wissen und die Ideen eines Erwachsenen sowie auf ihre eigenen Erfahrungen. Am Ende des Vorschulalters werden das Selbstwertgefühl des Kindes und seine wertenden Urteile über andere allmählich vollständiger, tiefer, detaillierter und erweitert.
Diese Veränderungen lassen sich zu einem großen Teil durch das Aufkommen des Interesses älterer Vorschulkinder an der inneren Welt der Menschen, ihren Übergang zur persönlichen Kommunikation, die Aneignung wichtiger Kriterien für die Bewertungstätigkeit und die Entwicklung des Denkens und Sprechens erklären. Das Selbstwertgefühl eines Vorschulkindes spiegelt seine sich entwickelnden Gefühle von Stolz und Scham wider.
Die Entwicklung des Selbstbewusstseins steht in engem Zusammenhang mit der Bildung der kognitiven und motivierenden Sphäre des Kindes. Aufgrund ihrer Entwicklung stellt sich am Ende der Vorschulzeit eine wichtige Neubildung ein – das Kind erweist sich in besonderer Form als fähig, sich seiner selbst und der Position, die es gerade einnimmt, bewusst zu werden, das heißt, das Kind erwirbt „ Bewusstsein für sein soziales „Ich“ und die Entstehung dieser Grundlage der inneren Position.“ Diese Verschiebung in der Entwicklung des Selbstwertgefühls ist wichtig für die psychologische Bereitschaft eines Vorschulkindes, in der Schule zu lernen, beim Übergang in die nächste Altersstufe. Bis zum Ende der Vorschulzeit nimmt auch die Unabhängigkeit und Kritikalität der Einschätzung und des Selbstwertgefühls der Kinder zu.
In der Vorschulkindheit beginnt sich ein weiterer wichtiger Indikator für die Entwicklung des Selbstbewusstseins herauszubilden – das rechtzeitige Bewusstsein für sich selbst. Das Kind lebt zunächst nur in der Gegenwart. Mit der Anhäufung und dem Bewusstsein seiner Erfahrungen wird ihm ein Verständnis seiner Vergangenheit zugänglich. Der älteste Vorschulkind bittet Erwachsene, darüber zu sprechen, wie klein er war, und er selbst erinnert sich gerne an einzelne Episoden der jüngeren Vergangenheit. Es ist charakteristisch, dass das Kind, völlig unbewusst über die Veränderungen, die im Laufe der Zeit in ihm selbst stattfinden, versteht, dass es früher anders war als jetzt: Es war klein, aber jetzt ist es erwachsen. Er interessiert sich auch für die Vergangenheit seiner Lieben. Der Vorschulkind entwickelt die Fähigkeit zur Verwirklichung und das Kind möchte zur Schule gehen, einen Beruf erlernen, wachsen, um bestimmte Vorteile zu erlangen. Das Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten und Qualitäten, die Darstellung seiner selbst in der Zeit, die Entdeckung seiner Erfahrungen – all dies stellt die anfängliche Form des Selbstbewusstseins eines Kindes dar, die Entstehung des persönlichen Bewusstseins. Es erscheint gegen Ende des Schulalters und setzt eine neue Ebene des Bewusstseins für seinen Platz im Beziehungssystem mit Erwachsenen voraus (d. h. jetzt versteht das Kind, dass es noch nicht groß, sondern klein ist).
Ein wichtiger Bestandteil des Selbstbewusstseins ist das Bewusstsein der Zugehörigkeit zum männlichen oder weiblichen Geschlecht, also der Geschlechtsidentität. Primäres Wissen darüber entwickelt sich in der Regel im Alter von eineinhalb Jahren. Mit zwei Jahren kann das Baby zwar sein Geschlecht kennen, seine Zugehörigkeit dazu jedoch nicht rechtfertigen. Im Alter von drei oder vier Jahren unterscheiden Kinder klar das Geschlecht ihrer Mitmenschen und kennen ihr Geschlecht, assoziieren es jedoch oft nicht nur mit bestimmten somatischen Eigenschaften und Verhaltenseigenschaften, sondern auch mit zufälligen äußeren Zeichen wie Frisur, Kleidung und Erlaubnis die Möglichkeit, das Geschlecht zu ändern.
Im gesamten Vorschulalter sind die Prozesse der sexuellen Sozialisation und sexuellen Differenzierung intensiv. Sie bestehen in der Aneignung von Orientierungen an den Werten des eigenen Geschlechts, in der Aneignung sozialer Bestrebungen, Einstellungen und Verhaltensstereotypen. Nun achtet der Vorschulkind auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen nicht nur im Aussehen, in der Kleidung, sondern auch in ihrem Verhalten. Die Grundlagen für Vorstellungen über Männlichkeit und Weiblichkeit werden gelegt. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen bei den Präferenzen für Aktivitäten, Arten von Aktivitäten und Spielen sowie Kommunikation nehmen zu. Am Ende des Vorschulalters erkennt das Kind die Irreversibilität seines Geschlechts und baut sein Verhalten darauf auf.
Die letzte Dimension des „Ich“, die Existenzform des globalen Selbstwertgefühls, ist das Selbstwertgefühl des Einzelnen. Das Selbstwertgefühl ist ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal und es ist ein wichtiges Anliegen des Einzelnen, es auf einem bestimmten Niveau zu halten. Das Selbstwertgefühl eines Menschen wird durch das Verhältnis seiner tatsächlichen Leistungen zu dem, was er zu erreichen behauptet und welchen Zielen er sich setzt, bestimmt. Selbstwertgefühl ist eines der sozialen Gefühle eines Menschen, das mit der Entwicklung einer persönlichen Qualität wie Selbstvertrauen verbunden ist und eine wichtige Rolle bei der Persönlichkeitsbildung eines Kindes spielt.
Im Vorschulalter sind Beurteilung und Selbstwertgefühl emotionaler Natur. Von den umliegenden Erwachsenen werden diejenigen am positivsten bewertet, für die das Kind Liebe, Vertrauen und Zuneigung empfindet. Ältere Kinder im Vorschulalter bewerten häufiger die innere Welt der Erwachsenen um sie herum und geben ihnen eine tiefere Einschätzung.
Die Selbsteinschätzung eines Vorschulkindes hängt weitgehend von der Einschätzung des Erwachsenen ab. Niedrige Schätzungen wirken sich am negativsten aus. Und überhöhte Werte verzerren die Vorstellungen der Kinder über ihre Fähigkeit, die Ergebnisse zu übertreiben. Gleichzeitig spielen sie aber auch eine positive Rolle bei der Organisation von Aktivitäten und mobilisieren die Kräfte des Kindes.
Je genauer der bewertende Einfluss des Erwachsenen ist, desto genauer ist das Verständnis des Kindes für die Ergebnisse seiner Handlungen. Eine ausgeprägte Vorstellung vom eigenen Handeln hilft dem Vorschulkind, den Einschätzungen der Erwachsenen kritisch gegenüberzustehen und sich ihnen teilweise zu widersetzen. Je jünger das Kind ist, desto unkritischer nimmt es die Meinung der Erwachsenen über sich selbst wahr. Ältere Kinder im Vorschulalter interpretieren die Einschätzungen von Erwachsenen durch das Prisma der Einstellungen und Schlussfolgerungen, die ihnen ihre Erfahrung sagt. Ein Kind kann den verzerrenden Bewertungseinflüssen von Erwachsenen bis zu einem gewissen Grad sogar widerstehen, wenn es die Ergebnisse seines Handelns selbstständig analysieren kann.
Es ist der Erwachsene, der die Entstehung und Entwicklung evaluativer Aktivitäten beim Kind stimuliert, wenn: es seine Einstellung zur Umwelt und seinen evaluativen Ansatz zum Ausdruck bringt; organisiert die Aktivitäten des Kindes, sorgt dafür, dass bei einzelnen Aktivitäten Erfahrungen gesammelt werden, stellt eine Aufgabe, zeigt Lösungswege auf und bewertet die Leistung; präsentiert Beispiele von Aktivitäten und gibt dem Kind damit Kriterien für die Richtigkeit seiner Umsetzung; organisiert gemeinsame Aktivitäten mit Gleichaltrigen, die dem Kind helfen, eine gleichaltrige Person zu sehen, seine Wünsche zu berücksichtigen, seine Interessen zu berücksichtigen und auch Muster erwachsener Aktivitäten und Verhaltensweisen in Kommunikationssituationen mit Gleichaltrigen zu übertragen (M. I. Lisina, D. B. Godovikova , usw. .).
Für die bewertende Tätigkeit muss ein Erwachsener in der Lage sein, im Umgang mit Kindern Freundlichkeit zum Ausdruck zu bringen, ihre Forderungen und Bewertungen zu rechtfertigen, um die Notwendigkeit ersterer zu zeigen, Bewertungen flexibel und ohne Stereotypen zu verwenden und negative Bewertungen durch die Kombination mit vorausschauenden positiven abzumildern. Bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen stärken positive Beurteilungen bewährte Verhaltensweisen und erweitern die Eigeninitiative des Kindes. Und die negativen: Sie strukturieren Aktivitäten und Verhalten neu und konzentrieren sich auf das Erreichen des gewünschten Ergebnisses. Eine positive Bewertung als Ausdruck der Zustimmung anderer verliert in Ermangelung einer negativen Bewertung ihre erzieherische Wirkung, da das Kind den Wert ersterer nicht spürt. Nur eine ausgewogene Kombination positiver und negativer Bewertungen schafft günstige Voraussetzungen für die Ausbildung wertenden und selbstbewertenden Handelns eines Vorschulkindes.
Das Vorschulalter zeichnet sich dadurch aus, dass Kinder in diesem Alter großen Wert auf die Einschätzungen der Erwachsenen legen. Das Kind erwartet eine solche Einschätzung nicht, sondern sucht sie aktiv selbst, strebt danach, Lob zu erhalten und bemüht sich sehr, es zu verdienen. Auch im Vorschulalter geben Kinder ihren eigenen Qualitäten ein positives oder negatives Selbstwertgefühl. So sammelt das Kind unter dem Einfluss der Eltern Wissen und Vorstellungen über sich selbst und entwickelt die eine oder andere Art von Selbstwertgefühl. Als günstige Voraussetzung für die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls können die emotionale Beteiligung der Eltern am Leben des Kindes, unterstützende und vertrauensvolle Beziehungen sowie Beziehungen angesehen werden, die die Entwicklung seiner Unabhängigkeit und die Bereicherung individueller Erfahrungen nicht beeinträchtigen.
Abschluss
Das Problem der Selbstwahrnehmung ist eines der schwierigsten in der Psychologie. Der effektivste Weg, dies zu untersuchen, besteht darin, die Entstehung des Selbstbewusstseins zu untersuchen, das hauptsächlich unter dem Einfluss von zwei Hauptfaktoren entsteht – den eigenen praktischen Aktivitäten des Kindes und seinen Beziehungen zu anderen Menschen. Das Vorschulalter gilt als Anfangsstadium der Persönlichkeitsbildung. Das ältere Vorschulalter nimmt in der Kindheit einen besonderen Platz ein. Ein Kind in diesem Alter beginnt, seine Erfahrungen zu erkennen und zu verallgemeinern, es bildet sich eine innere soziale Position, ein stabileres Selbstwertgefühl und eine entsprechende Einstellung zu Erfolg und Misserfolg in der Aktivität. Es gibt eine Weiterentwicklung der Komponente des Selbstbewusstseins – des Selbstwertgefühls. Es entsteht auf der Grundlage von Wissen und Gedanken über sich selbst.
Bis zum Ende des Vorschulalters werden das Selbstwertgefühl des Kindes und seine wertenden Urteile über andere allmählich vollständiger, tiefer, detaillierter und erweitert.
Merkmale der Entwicklung des Selbstwertgefühls im Vorschulalter: die Erhaltung eines allgemein positiven Selbstwertgefühls; die Entstehung einer kritischen Haltung gegenüber der Selbsteinschätzung bei Erwachsenen und Gleichaltrigen; es entwickelt sich ein Bewusstsein für die eigenen körperlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, moralischen Qualitäten, Erfahrungen und einige mentale Prozesse; - am Ende des Vorschulalters entwickelt sich Selbstkritik; Fähigkeit, das Selbstwertgefühl zu motivieren.
Die Bildung des Selbstbewusstseins, ohne die die Persönlichkeitsbildung nicht möglich ist, ist also ein komplexer und langwieriger Prozess, der die geistige Entwicklung insgesamt charakterisiert. Es entsteht unter dem direkten Einfluss anderer, vor allem Erwachsener, die ein Kind großziehen. Die Kommunikation des Kindes mit Erwachsenen ist für die Entstehung des Selbstwertgefühls in den ersten Phasen der Persönlichkeitsentwicklung (Ende der frühen, Beginn der Vorschulzeit) von entscheidender Bedeutung.
Referenzliste
1. Ankudinova N. E. Zur Entwicklung des Selbstbewusstseins bei Kindern / Psychologie eines Vorschulkindes: Leser. Komp. G.A. Uruntaeva. M.: „Akademie“, 2000.-
2. Belkina V. N. Psychologie der frühen und Vorschulkindheit / Lehrbuch - Jaroslawl, 1998. -248 S.
Bozhovich L. I. Persönlichkeit und ihre Entstehung in der Kindheit. - M., 1968 - 524 S.
Bolotova A.K. Entwicklung des persönlichen Selbstbewusstseins: Zeitlicher Aspekt // Fragen der Psychologie. - 2006, Nr. 2. - S. 116 - 125.
Volkov B. S. Vorschulpsychologie: Geistige Entwicklung von der Geburt bis zur Schule: ein Lehrbuch für Universitäten / B. S. Volkov, N.V. Wolkowa. - Ed. 5., überarbeitet und zusätzlich - M.: Academic Project, 2007.- 287 S.- (Gaudemus).
Garmaeva T.V. Merkmale der emotionalen Sphäre und des Selbstbewusstseins im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung eines Vorschulkindes // Psychologin im Kindergarten. - 2004, Nr. 2. - C 103-111.
7.Zaporozhets A.V. Zur Psychologie von Kindern im Früh- und Vorschulalter. - M., 1969.
Zinko E.V. Zusammenhang zwischen den Merkmalen des Selbstwertgefühls und dem Niveau der Ambitionen. Teil 1. Selbstwertgefühl und seine Parameter // Psychological Journal. - 2006. Band 27, Nr. 3.
Maralov V.G. Grundlagen der Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung: Lehrbuch für Studierende. Durchschn. Päd. Lehrbuch Betriebe. - M.: Verlagszentrum „Akademie“, 2002
Nemov R.S. Psychologie: Lehrbuch für höhere Studierende. Päd. Lehrbuch Institutionen: In 3 Büchern - Buch. 3: Psychodiagnostik. Einführung in die wissenschaftliche psychologische Forschung mit Elementen der mathematischen Statistik – 3. Aufl. – M.: Humanit. Ed. VLADOS-Zentrum, 1998
Uruntaeva GA. Vorschulpsychologie. - M.: „Akademie“, 1998.
§ 3. Entwicklung des Selbstbewusstseins im Vorschulalter
Für einen Vorschulkind umfasst der Inhalt des Selbstbildes eine Widerspiegelung seiner Eigenschaften, Qualitäten und Fähigkeiten. Durch die Erfahrung verschiedener Aktivitäten und die Kommunikation mit Erwachsenen und Gleichaltrigen sammeln sich nach und nach Daten über die eigenen Fähigkeiten an. Die Vorstellungen des Kindes über sich selbst werden durch eine angemessene Einstellung zu sich selbst ergänzt. Die Bildung eines Selbstbildes erfolgt auf der Grundlage der Herstellung von Verbindungen zwischen der individuellen Erfahrung des Kindes und den Informationen, die es im Kommunikationsprozess erhält. Indem das Kind Kontakte zu Menschen knüpft, sich mit ihnen vergleicht und die Ergebnisse seiner Aktivitäten mit den Ergebnissen anderer Kinder vergleicht, gewinnt es nicht nur neue Erkenntnisse über den anderen, sondern auch über sich selbst.
Ein Vorschulkind entwickelt die komplexeste Komponente des Selbstbewusstseins – das Selbstwertgefühl. Es entsteht auf der Grundlage von Wissen und Gedanken über sich selbst.
Die Selbsteinschätzung eines Vorschulkindes hängt weitgehend davon ab, wie ein Erwachsener ihn einschätzt. Niedrige Schätzungen wirken sich am negativsten aus. Und überhöhte Werte verzerren die Vorstellungen der Kinder über ihre Fähigkeit, die Ergebnisse zu übertreiben. Gleichzeitig spielen sie aber auch eine positive Rolle bei der Organisation von Aktivitäten und mobilisieren die Kräfte des Kindes.
Je genauer der bewertende Einfluss des Erwachsenen ist, desto genauer ist das Verständnis des Kindes für die Ergebnisse seiner Handlungen. Und andererseits hilft eine geformte Vorstellung vom eigenen Handeln dem Vorschulkind, den Einschätzungen der Erwachsenen kritisch gegenüberzustehen und sich ihnen teilweise zu widersetzen. Je jünger das Kind ist, desto unkritischer nimmt es die Meinung der Erwachsenen über sich selbst wahr. Ältere Kinder im Vorschulalter interpretieren die Einschätzungen von Erwachsenen durch das Prisma der Einstellungen und Schlussfolgerungen, die ihnen ihre Erfahrung sagt. Ein Kind kann den verzerrenden Bewertungseinflüssen von Erwachsenen bis zu einem gewissen Grad sogar widerstehen, wenn es die Ergebnisse seines Handelns selbstständig analysieren kann. Charakteristisch ist, dass sich das Kind in diesem Alter von der Einschätzung anderer distanziert. Das Wissen eines Vorschulkindes um die Grenzen seiner Kräfte beruht nicht nur auf der Kommunikation mit Erwachsenen, sondern auch auf seiner eigenen praktischen Erfahrung. Kinder mit hohem oder niedrigem Selbstbild reagieren empfindlicher auf die bewertenden Einflüsse von Erwachsenen und lassen sich leichter von ihnen beeinflussen.
Im Gegensatz zu früheren Lebensabschnitten eines Kindes beginnt die Kommunikation mit Gleichaltrigen im Alter von 3 bis 7 Jahren eine immer wichtigere Rolle im Prozess der Selbsterkenntnis eines Vorschulkindes zu spielen. Ein Erwachsener ist ein unerreichbarer Maßstab und man kann sich leicht mit Gleichaltrigen vergleichen. Beim Austausch bewertender Einflüsse entsteht eine bestimmte Haltung gegenüber anderen Kindern und gleichzeitig entwickelt sich die Fähigkeit, sich selbst durch deren Augen zu sehen. Die Fähigkeit eines Kindes, die Ergebnisse seiner eigenen Aktivitäten zu analysieren, hängt direkt von seiner Fähigkeit ab, die Ergebnisse anderer Kinder zu analysieren. So entwickelt sich in der Kommunikation mit Gleichaltrigen die Fähigkeit, eine andere Person zu bewerten, was die Entstehung von Selbstwertgefühl anregt.
Je jünger die Kinder im Vorschulalter sind, desto weniger aussagekräftig sind die Beurteilungen durch Gleichaltrige für sie. Im Alter von 3 bis 4 Jahren sind die gegenseitigen Einschätzungen der Kinder subjektiver und werden häufiger von ihrer emotionalen Einstellung zueinander beeinflusst. Kinder sind kaum in der Lage, die Handlungen ihrer Kameraden in verschiedenen Situationen zu verallgemeinern und unterscheiden inhaltlich ähnliche Eigenschaften nicht (T.A. Repina). Im frühen Vorschulalter sind positive und negative Peer-Bewertungen gleichmäßig verteilt. Bei älteren Vorschulkindern überwiegen positive. Kinder im Alter von 4,5 bis 5,5 Jahren sind am anfälligsten für Beurteilungen durch Gleichaltrige. Die Fähigkeit, sich mit Freunden zu vergleichen, erreicht bei Kindern im Alter von 5 bis 7 Jahren ein sehr hohes Niveau. Bei älteren Vorschulkindern hilft die reichhaltige Erfahrung individueller Aktivitäten dabei, den Einfluss von Gleichaltrigen kritisch zu bewerten.
Einen wichtigen Platz bei der Beurteilung von Gleichaltrigen in jedem Alter nehmen ihre geschäftlichen Qualitäten, Fähigkeiten und Fertigkeiten ein, die den Erfolg gemeinsamer Aktivitäten gewährleisten, sowie ihre moralischen Qualitäten. In einer Kindergartengruppe gibt es ein Wertesystem, das die gegenseitige Einschätzung der Kinder bestimmt. Das Spektrum der moralischen Manifestationen, die ein Kind mit dem Begriff „gut“ in Bezug auf Gleichaltrige und sich selbst verbindet, erweitert sich allmählich. Mit 4-5 Jahren ist er klein (niemanden schlagen, auf den Lehrer, die Mutter hören). Mit 5-6 Jahren wird es größer, obwohl sich die noch genannten Eigenschaften nur auf Beziehungen im Kindergarten und in der Familie beziehen (Kinder beschützen, nicht schreien, nicht herumspielen, vorsichtig sein, nicht bereuen, wenn man etwas gibt, helfen Mutter, teile Spielzeug). Im Alter von 6 bis 7 Jahren werden moralische Normen von Vorschulkindern besser verstanden und gelten für die Menschen in der weiteren Umgebung (nicht kämpfen, gehorchen, mit allen befreundet sein, Spiele spielen, alle behandeln, den Jüngeren helfen, nichts tun). Rufen Sie keine Namen an, lügen Sie nicht, beleidigen Sie niemanden, geben Sie älteren Menschen den Vortritt. Im Alter von 6 bis 7 Jahren verstehen die meisten Kinder die moralischen Eigenschaften richtig, anhand derer sie ihre Altersgenossen bewerten: Fleiß, Ordentlichkeit, Fähigkeit, zusammen zu spielen, Fairness usw.
Für einen Vorschulkind ist es viel schwieriger, sich selbst einzuschätzen als für einen Gleichaltrigen. Das Kind stellt höhere Ansprüche an Gleichaltrige und bewertet sie objektiver. Das Selbstwertgefühl eines Vorschulkindes ist sehr emotional. Er bewertet sich selbst leicht positiv. Ein negatives Selbstwertgefühl wird laut T.A. Repina nur bei wenigen Kindern im siebten Lebensjahr beobachtet.
Der Grund für die unzureichende Beurteilung liegt darin, dass es für einen Vorschulkind, insbesondere für einen jüngeren, sehr schwierig ist, seine Fähigkeiten von seiner eigenen Persönlichkeit als Ganzes zu trennen. Zuzugeben, dass er etwas Schlimmeres getan hat oder tut als andere Kinder, bedeutet für ihn, zuzugeben, dass es ihm im Allgemeinen schlechter geht als seinen Altersgenossen. Daher ist selbst ein älterer Vorschulkind oft nicht in der Lage, dies zuzugeben, wenn er erkennt, dass er etwas falsch gemacht oder getan hat. Er versteht, dass es hässlich ist, zu prahlen, aber der Wunsch, gut zu sein und sich von anderen Kindern abzuheben, ist so stark, dass das Kind oft auf Tricks zurückgreift, um indirekt seine Überlegenheit zu zeigen.
Maxim D. (5 Jahre 9 Monate) engagiert sich in einem Tanzclub. Auf die ständigen Fragen eines Erwachsenen: „Wer hat die Bewegungen heute besser ausgeführt?“ antwortet: „Natürlich bin ich das.“ Eine solche Antwort befriedigt den Erwachsenen nicht und er erklärt dem Jungen geduldig, dass es hässlich sei, „Ich bin der Beste“ zu wiederholen. Als nach dem Unterricht noch einmal ein Erwachsener fragt: „Wer hat heute besser getanzt?“, antwortet Maxim: „Anton.“ Und dann fügt er hastig hinzu: „Ich mache das aus Bescheidenheit ...“
Ältere Kinder im Vorschulalter vermeiden oft die Beantwortung einer Frage wie „Wer ist der Beste in Ihrer Gruppe?“ und antworten: „Ich weiß nicht ... Ich bin auch gut im Dienst (ich streite nicht, ich bin freundlich, usw.)." Gleichzeitig sagen jüngere Kinder ohne zu zögern: „Mir geht es besser.“
Oft sind Kinder stolz auf Eigenschaften, die sie nicht besitzen, und sprechen von fiktiven Erfolgen. Dies geschieht aus mehreren Gründen. R.Kh. Shakurov zeigte, dass ein Kind, das sich selbst bestimmte Eigenschaften zuschreibt, nicht immer die Bedeutung des entsprechenden Wortes versteht, sondern nur seine bewertende Bedeutung erkennt: Es ist gut, so zu sein. Daher die Diskrepanz zwischen seinem Selbstwertgefühl und der Realität. Darüber hinaus kann ein Vorschulkind sein Seelenleben nicht vollständig verstehen und seine Qualitäten oder Eigenschaften nicht erkennen. Daher sind Kinder oft stolz auf Eigenschaften, die sie in geringem Maße besitzen. Bei der Selbsteinschätzung strebt das Kind nach einem positiven Selbstwertgefühl; es möchte zeigen, dass es für andere etwas Wertvolles darstellt. Und wenn Erwachsene und Gleichaltrige seine positiven Eigenschaften nicht bemerken, dann stattet er sich mit fiktiven aus.
Mit zunehmendem Alter wird das Selbstwertgefühl immer korrekter und spiegelt die Fähigkeiten des Kindes besser wider. Zunächst tritt es bei produktiven Aktivitäten und bei Spielen mit Regeln auf, bei denen Sie Ihr Ergebnis klar sehen und mit dem Ergebnis anderer Kinder vergleichen können. Mit echter Unterstützung: einer Zeichnung, einem Entwurf fällt es Vorschulkindern leichter, sich selbst eine richtige Einschätzung zu geben.
Im Alter von 3-4 Jahren überschätzt ein Kind seine Leistungsfähigkeit, weiß wenig über persönliche Qualitäten und kognitive Fähigkeiten und verwechselt oft konkrete Leistungen mit einer hohen persönlichen Einschätzung. Vorbehaltlich entwickelter Kommunikationserfahrung kennt ein 5-jähriges Kind nicht nur seine Fähigkeiten, sondern hat auch eine Vorstellung von kognitiven Fähigkeiten, persönlichen Qualitäten, Aussehen und reagiert angemessen auf Erfolg und Misserfolg. Im Alter von 6-7 Jahren hat ein Vorschulkind eine gute Vorstellung von seinen körperlichen Fähigkeiten, schätzt diese richtig ein und entwickelt eine Vorstellung von seinen persönlichen Qualitäten und geistigen Fähigkeiten.
Die egoistische Position besteht darin, dass das Kind anderen Kindern gegenüber gleichgültig ist und seine Interessen auf Objekte gerichtet sind. Daher greifen solche Kinder oft zu Unhöflichkeit und Aggressivität gegenüber ihrem Freund. Typischerweise wissen Vorschulkinder mit dieser Position nichts über ihre Altersgenossen und erinnern sich nicht einmal immer an deren Namen. Aber das Kind bemerkt immer die Spielsachen, die andere mitbringen. Diese Position ist nicht nur für Gleichaltrige, sondern auch für das Kind selbst schädlich. Seine Kameraden mögen ihn nicht, sie wollen nicht mit ihm spielen oder mit ihm befreundet sein. Dadurch wird er noch aggressiver.
Die Wettbewerbsposition besteht darin, dass das Kind versteht: Um geliebt, respektiert und geschätzt zu werden, muss man gehorsam und gut sein und darf niemanden beleidigen. Ein solches Kind wird von den Lehrern geliebt und gelobt. Er strebt nach Anerkennung in der Gruppe seiner Mitmenschen. Aber sie interessieren ihn nur als Mittel zur Selbstbestätigung. Das Kind verfolgt aufmerksam die Erfolge anderer und freut sich über deren Misserfolge. Er bewertet seinen Kollegen im Hinblick auf seine eigenen Verdienste unzureichend. Natürlich fungiert diese Position gewissermaßen als altersbedingtes Verhaltensmerkmal in der Kommunikation mit Gleichaltrigen, sie sollte jedoch nicht bis zum Ende des Vorschulalters das Hauptmerkmal bleiben.
Ein Kind mit einer humanen Einstellung behandelt seinen Freund als eigenständige, wertvolle Person. Er hat eine positive Einstellung gegenüber seinen Kameraden, ist sehr sensibel für den inneren Zustand anderer und kennt die Interessen, Stimmungen und Wünsche seiner Mitmenschen gut. Er teilt bereitwillig aus eigener Initiative, was er hat, hilft anderen nicht in der Hoffnung auf Lob, sondern weil er selbst Freude und Befriedigung daraus empfindet.
Allmählich steigt die Fähigkeit von Vorschulkindern, das Selbstwertgefühl zu motivieren, und auch der Inhalt der Motivationen ändert sich. Eine Studie von T.A. Repina zeigt, dass 4-5-jährige Kinder ihr Selbstwertgefühl vor allem nicht mit ihren eigenen Erfahrungen, sondern mit der Bewertungshaltung anderer assoziieren: „Ich bin gut, weil der Lehrer mich lobt.“ Im Alter von 5 bis 7 Jahren begründen Vorschulkinder ihre positiven Eigenschaften mit dem Vorhandensein moralischer Qualitäten. Aber selbst im Alter von 6 bis 7 Jahren können nicht alle Kinder ihr Selbstwertgefühl fördern.
Im Alter von 7 Jahren durchläuft ein Kind eine wichtige Veränderung im Selbstwertgefühl. Es geht vom Allgemeinen zum Differenzierten. Das Kind zieht Rückschlüsse auf seine Leistungen bei verschiedenen Aktivitäten. Er merkt, dass er mit manchen Dingen besser zurechtkommt, mit anderen schlechter.
Geben wir ein Beispiel.
Erwachsener: Maxim, wer in deiner Gruppe isst am schnellsten?
Maxim D. (6 Jahre): Ich natürlich!
Erwachsener: Wer denkt in Ihrer Klasse am schnellsten?
Maxim (konzentriertes Gesicht, spricht leise): Mischa, er ist immer der Erste, der seine Hand hebt.
Vor dem 5. Lebensjahr überschätzen Kinder meist ihre Fähigkeiten. Und im Alter von 5 bis 6,5 Jahren loben sie sich selbst selten, obwohl die Tendenz zur Prahlerei bestehen bleibt. Gleichzeitig nimmt die Zahl der fundierten Schätzungen zu. Im Alter von 7 Jahren haben die meisten Kinder sich selbst richtig eingeschätzt und sind sich ihrer selbst bei verschiedenen Arten von Aktivitäten bewusst.
Im 7. Lebensjahr beginnt das Kind, zwei Aspekte des Selbstbewusstseins zu unterscheiden – Selbsterkenntnis und Einstellung zu sich selbst.
So beobachtet man bei einer Selbsteinschätzung: „Manchmal gut, mal schlecht“ eine emotional positive Einstellung sich selbst gegenüber („Ich mag mich“) oder bei einer allgemein positiven Einschätzung „Gut“ eine verhaltene emotionale Werthaltung ( „Ich mag mich ein bisschen“) wird beobachtet. Bei 4-jährigen Kindern besteht häufiger die Tendenz, ihre emotionale und wertebasierte Einstellung zu sich selbst auf ästhetische Reize statt auf ethische Reize zu stützen („Ich mag mich selbst, weil ich schön bin“). Im Alter von 4 bis 5 Jahren ist der Wunsch erkennbar, etwas an sich selbst zu verändern, obwohl dies nicht auf die Merkmale des moralischen Charakters beschränkt ist. Im höheren Vorschulalter steigt neben der Zufriedenheit der meisten Kinder mit sich selbst auch der Wunsch, etwas an sich zu verändern, anders zu werden.
Geben wir ein Beispiel.
Maxim D. (6 Jahre alt) ist ein sehr aktives Kind. Damit er der Bitte des Erwachsenen nachkommen kann, ist es notwendig, ihn zu rügen. „Maxim, du bist so unartig“, bemerkt ein Erwachsener oft. Als Maxim erneut von seinem Ungehorsam hört, sagt er traurig: „Warum, warum bin ich so!?“ So möchte ich nicht sein!“
Ältere Vorschulkinder erkennen nicht nur ihre Qualitäten, sondern versuchen auch, die Motive ihres eigenen Handelns und des Handelns anderer zu verstehen. Sie beginnen, ihr eigenes Verhalten zu erklären und stützen sich dabei auf das Wissen und die Ideen eines Erwachsenen sowie auf ihre eigenen Erfahrungen.
So begründet Maxim D. (6 Jahre alt): „Ich, Mama, habe Angst vor dir, deshalb betrüge ich... (lächelt). Nur ein Scherz ... Alles Geheimnis kommt irgendwann ans Licht. Das Geheimnis kommt immer ans Licht ...“
Bei der Erklärung des Handelns anderer Menschen geht ein Vorschulkind oft von seinen eigenen Interessen und Werten aus, also seiner eigenen Position gegenüber der Umwelt.
Geben wir ein Beispiel.
Maxim D. (6 Jahre alt) suchte sich im Laden ein Designer-Set aus. Der Junge wollte ein Auto kaufen, das für Kinder im Alter von 9 bis 10 Jahren konzipiert war. Der Verkäufer riet ihm davon ab, indem er erklärte, dass er noch zu klein für ein solches Spielzeug sei, und schlug vor, einen anderen Baukasten zu nehmen. Der Junge bestand darauf. Doch Versuche, das gewählte Auto selbst zu bauen, blieben erfolglos. "Wie schwer!" - sagte Maxim. Darauf antwortete der Erwachsene: „Der Verkäufer hat Ihnen gesagt, wählen Sie ein anderes.“ Maxim: „Ich weiß, warum sie das gesagt hat ... Sie mochte dieses Auto selbst.“
Allmählich beginnt der Vorschulkind, sich nicht nur seiner moralischen Qualitäten, sondern auch seiner Erfahrungen und seines emotionalen Zustands bewusst zu werden.
Lassen Sie uns Beispiele nennen.
Als seine Mutter Andryusha V. (4 Jahre 11 Monate) zwang, die Suppe aufzuessen, sagte der Junge: „Mama, du hast mich so verärgert!“
Maxim S. (6 Jahre 2 Monate) und Maxim D. (6 Jahre) sind Freunde. Am Montag wurde Maxim D. nicht in den Kindergarten gebracht. Während des Spaziergangs ging Maxim S. um das Gelände herum und legte sich auf den Schnee. „Maxim, warum liegst du da?“ - fragte den Lehrer. Und der Junge antwortete: „Mir ist so langweilig. Maxim ist weg, es gibt niemanden zum Spielen.“
Der ältere Vorschulkind ist auch an einigen mentalen Prozessen interessiert, die in ihm selbst ablaufen.
Kinder stellen zum Beispiel Fragen: „Woher kommen Gedanken?“ (Dasha N., 5 Jahre 3 Monate), „Warum denke ich in Worten und spreche nicht?“ (Maxim D., 5 Jahre und Monate). Eine Erklärung finden Kinder in der Aussage: „Gedanken kommen einem von selbst in den Kopf, sie schleichen sich in den Kopf“ (Dasha N.), „Man schaut sich etwas an, und es gibt immer mehr Gedanken... es gibt mehr und mehr“ (Maxim D.).
Natürlich sind solche Erklärungen weit von der Wahrheit entfernt, zu spezifisch und vage. Wichtig ist jedoch, dass sich das Kind nicht nur der äußeren Seite von Handlungen und Leistungen bewusst ist, sondern auch der inneren Zustände und Prozesse.
In der Vorschulkindheit beginnt sich ein weiterer wichtiger Indikator für die Entwicklung des Selbstbewusstseins herauszubilden – das rechtzeitige Bewusstsein für sich selbst. Das Kind lebt zunächst nur in der Gegenwart. Mit der Anhäufung und dem Bewusstsein seiner Erfahrungen wird ihm ein Verständnis seiner Vergangenheit zugänglich. Der älteste Vorschulkind bittet Erwachsene, darüber zu sprechen, wie klein er war, und er selbst erinnert sich gerne an einzelne Episoden der jüngeren Vergangenheit. Es ist charakteristisch, dass das Kind, ohne sich der Veränderungen bewusst zu sein, die sich im Laufe der Zeit in ihm vollziehen, versteht, dass es vorher nicht dasselbe war wie jetzt: Es war klein, aber jetzt ist es erwachsen. Er interessiert sich auch für die Vergangenheit seiner Lieben.
Geben wir ein Beispiel.
Maxim D. (6 Jahre): Warum bin ich so stark?
Erwachsener: Wahrscheinlich, weil Sie in Zukunft Sportler werden.
Maxime: Zukunft, Vergangenheit... Und was ist die Zukunft, Vergangenheit?
Erwachsener: Die Vergangenheit ist, was einmal war. Und die Zukunft ist das, was passieren wird.
Maxim: Ah... ich verstehe. Die Vergangenheit ist, als ich klein war und auf einem Blütenblatt lag ...
Der Vorschulkind entwickelt die Fähigkeit, die Zukunft zu begreifen. Das Kind möchte zur Schule gehen, einen Beruf erlernen, erwachsen werden, um sich gewisse Vorteile zu verschaffen.
Sich der eigenen Fähigkeiten und Qualitäten bewusst zu sein, sich selbst in der Zeit darzustellen, die eigenen Erfahrungen zu entdecken – all dies stellt die anfängliche Form des Selbstbewusstseins eines Kindes dar, die Entstehung des „persönlichen Bewusstseins“ (D.B. Elkonin). Es erscheint gegen Ende des Vorschulalters und bestimmt eine neue Ebene des Bewusstseins für seinen Platz im Beziehungssystem zu Erwachsenen (das heißt, das Kind versteht jetzt, dass es noch nicht groß, sondern klein ist).
Am Ende der frühen Kindheit erlernt das Kind seine Geschlechtsidentität. Im gesamten Vorschulalter finden die Prozesse der sexuellen Sozialisation und sexuellen Differenzierung intensiv statt. Sie bestehen in der Aneignung einer Orientierung an den Werten des eigenen Geschlechts, in der Aneignung sozialer Bestrebungen, Einstellungen und Stereotypen des Sexualverhaltens. Nun achtet der Vorschulkind nicht nur auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Aussehen und Kleidung, sondern auch in ihrem Verhalten. Die Grundlagen für Vorstellungen über Männlichkeit und Weiblichkeit werden gelegt. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen bei den Präferenzen für Aktivitäten, Arten von Aktivitäten und Spielen sowie Kommunikation nehmen zu. Am Ende des Vorschulalters erkennt das Kind die Irreversibilität seines Geschlechts und baut sein Verhalten darauf auf.
Merkmale der Entwicklung des Selbstbewusstseins im Vorschulalter:
Es entsteht eine kritische Haltung gegenüber der Beurteilung von Erwachsenen und Gleichaltrigen;
Die Beurteilung durch Gleichaltrige hilft dem Kind, sich selbst einzuschätzen.
Der Vorschulkind ist sich seiner körperlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, moralischen Qualitäten, Erfahrungen und einiger mentaler Prozesse bewusst;
Bis zum Ende des Vorschulalters entwickeln sich ein korrekt differenziertes Selbstwertgefühl und Selbstkritik;
Die Fähigkeit, das Selbstwertgefühl zu motivieren, entwickelt sich;
Sich selbst mit der Zeit bewusst zu werden, persönliches Bewusstsein erscheint.
| " |
Selbstbewusstsein ist die Vorstellung eines Menschen von seinen Beziehungen zur Umwelt, das Konzept seines „Ichs“ und seine Einstellungen zu sich selbst
Unter Selbstbewusstsein wird in der Psychologie ein mentales Phänomen verstanden, das Bewusstsein einer Person für sich selbst als Subjekt der Aktivität, wodurch die Vorstellungen einer Person über sich selbst zu einem mentalen „Bild-Ich“ geformt werden.
Das Kind erkennt sich selbst nicht sofort als „Ich“; In den ersten Jahren nennt er sich oft beim Namen – wie ihn sein Umfeld nennt; er existiert zunächst für sich selbst, eher als Objekt für andere Menschen, denn als unabhängiges Subjekt in Bezug auf sie.
Selbstbewusstsein ist keine dem Menschen innewohnende Anfangsvoraussetzung, sondern ein Produkt der Entwicklung. Die Anfänge des Identitätsbewusstseins treten jedoch bereits bei einem Säugling auf, wenn er beginnt, zwischen Empfindungen, die durch äußere Objekte verursacht werden, und Empfindungen, die durch seinen eigenen Körper verursacht werden, das Bewusstsein des „Ich“ zu unterscheiden – ab etwa drei Jahren, wenn das Kind damit beginnt Personalpronomen richtig verwenden. Das Bewusstsein für die eigenen geistigen Qualitäten und das Selbstwertgefühl erlangen im Jugend- und jungen Erwachsenenalter die größte Bedeutung. Da jedoch alle diese Komponenten miteinander verbunden sind, verändert die Anreicherung einer von ihnen zwangsläufig das gesamte System. Die Entdeckung des „Ich“ erfolgt im Alter von 1 Jahr. Im 2. bis 3. Lebensjahr beginnt ein Mensch, das Ergebnis seines Handelns von dem Handeln anderer zu trennen und versteht sich klar als Handelnder. Mit 7 Jahren wird die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung (Selbstwertgefühl) ausgebildet.
Die Bildung des Selbstbewusstseins wird beeinflusst durch: Einschätzungen anderer und Status in der Peergroup. Korrelation zwischen „realem Selbst“ und „idealem Selbst“. Bewerten Sie die Ergebnisse Ihrer Aktivitäten.
Laut Wolf Salomonovich Merlin ist Selbstbewusstsein ein komplexes psychologisches System, das vier Komponenten umfasst:
1) Bewusstsein des eigenen „Ich“;
2) Bewusstsein der eigenen Identität;
3) Bewusstsein für persönliche geistige Qualitäten;
4) System des sozialen und moralischen Selbstwertgefühls.
Alle diese Elemente sind miteinander verbunden, aber sie entstehen nicht gleichzeitig.
Selbsterkenntnis sollte als der Prozess der Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit, des eigenen „Ichs“ als physisches, spirituelles und soziales Wesen verstanden werden. Selbstbewusstsein ist Wissen und zugleich Einstellung zu sich selbst als einer bestimmten Person. Alle Aspekte der Persönlichkeit (physisch, spirituell, sozial) stehen in engster Einheit und beeinflussen sich gegenseitig. Der Prozess der Bewusstwerdung dieser Aspekte der Persönlichkeit ist ein komplexer, einheitlicher Prozess. Das Bewusstsein für sich selbst als physisches Wesen ist auch eine Haltung gegenüber sich selbst als einem bestimmten lebenden Organismus, der bestimmte physische Eigenschaften besitzt. Wenn wir über das Bewusstsein für uns selbst als spirituelles Wesen sprechen, stehen das Wissen und die Einstellung zu uns selbst als einer Person im Vordergrund, die weiß, erlebt und handelt. Schließlich besteht das Bewusstsein für sich selbst als soziales Wesen im Bewusstsein für die eigene soziale Rolle, den eigenen Platz im Team.
Die Entstehung und Entwicklung des Selbstbewusstseins eines Kindes in den ersten sieben Lebensjahren ist untrennbar mit der Entwicklung zwischenmenschlicher Beziehungen zu anderen verbunden.
Die Selbsterkenntnis als ständige Quelle vielfältiger Wünsche und Handlungen, getrennt von anderen Menschen, entsteht gegen Ende des dritten Lebensjahres unter dem Einfluss der wachsenden praktischen Unabhängigkeit des Kindes. Das Kind beginnt, die Ausführung verschiedener objektiver Handlungen ohne die Hilfe der Eltern zu meistern und erlernt die einfachsten Selbstbedienungsfähigkeiten. Er beherrscht aufrechtes Gehen, Sprechen und objektmanipulative Tätigkeiten. Er entwickelt besondere Gefühle, die in der Psychologie als Stolzgefühle bezeichnet werden: ein Gefühl des Stolzes und ein Gefühl der Scham (die primären Manifestationen der emotionalen Wertkomponente des Selbstbewusstseins). Am Ende dieser Zeit beginnt das Kind erstmals, sich als Individuum zu etablieren. Er beginnt zu verstehen, dass er es ist, der diese oder jene Handlung ausführt. Äußerlich drückt sich dieses Verständnis darin aus, dass das Kind nicht in der dritten, sondern in der ersten Person über sich selbst zu sprechen beginnt: „Ich selbst“, „Ich werde“, „Ich will“, „Gib mir“, „Nimm.“ ich mit dir." In der Kommunikation mit Erwachsenen lernt er, sich von anderen Menschen abzugrenzen.
Im Vorschulalter ist sich ein Kind nur noch seiner Existenz bewusst, ohne wirklich etwas über sich selbst und seine Qualitäten zu wissen. Wenn ein kleines Kind versucht, wie ein Erwachsener zu sein, berücksichtigt es nicht seine wahren Fähigkeiten.
Bald beginnt das Kind, sich mit Erwachsenen zu vergleichen. Er möchte wie ein Erwachsener sein, er möchte die gleichen Handlungen ausführen, die gleiche Unabhängigkeit und Autonomie genießen. Und nicht später (irgendwann), sondern jetzt, hier und sofort. Deshalb hat er den Wunsch, seinen Willen auszudrücken: Er strebt nach Unabhängigkeit, um seine Wünsche den Wünschen der Erwachsenen gegenüberzustellen. So entsteht eine frühe Alterskrise. Während dieser Zeit haben Erwachsene erhebliche Schwierigkeiten in der Beziehung zum Kind und sind mit seiner Sturheit und seinem Negativismus konfrontiert.
Der jüngere Vorschulkind hat noch keine fundierte und richtige Meinung über sich selbst, der sich einfach alle von Erwachsenen anerkannten positiven Eigenschaften zuschreibt, oft ohne zu wissen, was sie sind. Als ein Kind, das behauptet, ordentlich zu sein, gefragt wurde, was das bedeute, antwortete er: „Ich habe keine Angst.“ Andere Kinder, ebenfalls stolz auf ihre Sauberkeit, antworteten auf diese Frage: „Ich weiß es nicht.“
Um zu lernen, sich selbst richtig einzuschätzen, muss ein Kind zunächst lernen, andere Menschen einzuschätzen, die es wie von außen betrachten kann. Und das passiert nicht sofort. Während dieser Zeit wiederholt das Kind bei der Beurteilung von Gleichaltrigen einfach die Meinungen, die Erwachsene über es geäußert haben. Das Gleiche passiert mit dem Selbstwertgefühl („Mir geht es gut, weil meine Mutter es sagt“).
Die Geschlechtsidentifikation, also die Identifikation mit Angehörigen des gleichen Geschlechts, entwickelt sich etwa im Alter von drei Jahren, wenn das Kind lernt, sich selbst als zukünftigen Mann oder zukünftige Frau zu erkennen. „Ich bin ein Junge“ oder „Ich bin ein Mädchen“ werden zum Wissen und Glauben des Kindes. Das Bewusstsein für das eigene „Ich“ schließt hier als Norm durchaus auch das Bewusstsein für das eigene Geschlecht ein. Gefühle zum eigenen Geschlecht stabilisieren sich bei einem Kind normalerweise im frühen und mittleren Vorschulalter.
Je nach Selbstwahrnehmung als Junge oder Mädchen beginnt das Kind, Spielrollen für sich selbst auszuwählen. Gleichzeitig werden Kinder häufig nach Geschlecht in Spiele eingeteilt.
Im frühen und mittleren Vorschulalter zeigt sich eine wohlwollende Vorliebe gegenüber gleichgeschlechtlichen Kindern, die die Entwicklung des Selbstbewusstseins bestimmt.
Mit 3-4 Jahren unterscheiden Kinder nicht nur das Geschlecht der Menschen um sie herum, sondern wissen auch ganz genau, dass je nach Geschlecht unterschiedliche Anforderungen an einen Menschen gestellt werden: Mädchen spielen meist mit Puppen und kleiden sich wie Frauen, Jungen spielen mit Autos oder zum Beispiel zur Feuerwehr.
Im Alter von 4–5 Jahren hängt die eigenständige Einschätzung eines Kindes über andere Menschen, deren Handlungen und Qualitäten zunächst von seiner Einstellung gegenüber diesen Menschen ab. Dies zeigt sich insbesondere in der Beurteilung des Handelns von Figuren in Geschichten und Märchen. Jede Handlung mit gutem, positivem Charakter wird als gut bewertet, jede Handlung mit schlechtem Charakter wird als schlecht bewertet. Aber nach und nach löst sich die Beurteilung der Handlungen und Eigenschaften der Charaktere von der allgemeinen Einstellung ihnen gegenüber und beginnt, auf einem Verständnis der Situation und der Bedeutung dieser Handlungen und Eigenschaften aufzubauen. Nachdem das Kind das Märchen „Teremok“ gehört hat, beantwortet es die Fragen: „Hat der Bär Gutes oder Böses getan?“ - „Schlecht“. „Warum hat er etwas Schlimmes getan?“ - „Weil er den Turm zerstört hat.“ - „Magst du den Bären oder nicht?“ - "Gefällt. Ich liebe Bären.
Beim Lernen werden die Normen und Verhaltensregeln zu Maßstäben, anhand derer das Kind andere Menschen beurteilt. Die Anwendung dieser Maßnahmen auf sich selbst erweist sich jedoch als viel schwieriger. Die Erfahrungen, die das Kind fesseln und es zu bestimmten Handlungen drängen, verschleiern ihm die wahre Bedeutung der begangenen Handlungen und erlauben ihm keine unparteiische Bewertung. Eine solche Beurteilung wird nur auf der Grundlage eines Vergleichs der eigenen Handlungen und Qualitäten mit den Fähigkeiten, Handlungen und Qualitäten anderer Menschen möglich.
Auf die Frage, wer in der Gruppe die Lieder am besten singt, antwortet Marina: „Galya und ich. Lena singt gut. Und Galya und ich ein bisschen. Mir geht es ein bisschen gut und Galya ist ein bisschen gut.“
Im höheren Vorschulalter (6-7 Jahre) verändert sich die Einstellung zu sich selbst noch einmal deutlich. In diesem Alter beginnen Kinder, sich nicht nur ihrer spezifischen Handlungen und Qualitäten bewusst zu werden, sondern auch ihrer Wünsche, Erfahrungen, Motive, die im Gegensatz zu objektiven Merkmalen nicht Gegenstand von Beurteilung und Vergleich sind, sondern die Persönlichkeit des Kindes als Ganzes vereinen und festigen (Ich will, ich liebe, ich strebe usw.) All dies spiegelt sich in der Stärkung der subjektiven Komponente des Selbstbewusstseins und in Veränderungen in der Beziehung eines 6-7-jährigen Kindes zu anderen Menschen wider. Das eigene Selbst des Kindes ist nicht mehr so grausam auf seine Verdienste und die Einschätzung seiner objektiven Qualitäten fixiert, sondern ist offen für andere Menschen, ihre Freuden und Probleme. Das Selbstbewusstsein des Kindes geht über seine Objektmerkmale hinaus und ist offen für die Erfahrungen anderer. Ein anderes Kind wird nicht mehr nur zum Gegenstück, nicht nur zum Mittel der Selbstbestätigung und zum Subjekt des Vergleichs mit sich selbst, sondern auch zu einer selbstgeschätzten Persönlichkeit, zum Subjekt der Kommunikation und Zirkulation seines gesamten Selbst. Deshalb sind Kinder bereitwillig Helfen Sie Ihren Mitmenschen, haben Sie Mitgefühl mit ihnen und betrachten Sie die Erfolge anderer Menschen nicht als ihre eigene Niederlage.
Trotz der offensichtlichen Unterschiede in den Verhaltensausprägungen basieren alle problematischen Formen zwischenmenschlicher Beziehungen auf einer einzigen psychologischen Grundlage. Im Allgemeinen könnte es als Fixierung auf die eigenen objektiven Qualitäten oder als Vorherrschen einer bewertenden, objektbasierten Haltung gegenüber sich selbst und anderen definiert werden. Eine solche Fixierung führt zu einer ständigen Selbstbewertung und Selbstbestätigung.
Somit sind Selbstbewusstsein und Einstellung gegenüber anderen untrennbar miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig; In allen Phasen der Altersentwicklung spiegelt die Einstellung gegenüber anderen die Besonderheiten der Bildung des Selbstbewusstseins des Kindes und seiner gesamten Persönlichkeit wider.
Das Bewusstsein für das eigene Verhalten und der Beginn der persönlichen Selbsterkenntnis ist eine der wesentlichen neuen Entwicklungen im Vorschulalter. Ein älterer Vorschulkind beginnt zu verstehen, was er kann und was nicht, er kennt seinen begrenzten Platz im System der Beziehungen zu anderen Menschen, er ist sich nicht nur seiner Handlungen bewusst, sondern auch seiner inneren Erfahrungen – Wünsche, Vorlieben, Stimmungen , usw.
Einführung
Das Problem der Selbstwahrnehmung ist eines der schwierigsten in der Psychologie. Der effektivste Weg, dies zu untersuchen, besteht darin, die Entstehung des Selbstbewusstseins zu untersuchen, das hauptsächlich unter dem Einfluss von zwei Hauptfaktoren entsteht – den eigenen praktischen Aktivitäten des Kindes und seinen Beziehungen zu anderen Menschen.
Im Vorschulalter gilt die Entstehung des Selbstbewusstseins als wichtigste Errungenschaft der Persönlichkeitsentwicklung. Daher ist die Bestimmung der psychologischen Bedingungen für die Bildung des Selbstbewusstseins und die Identifizierung der Hauptursachen für unerwünschte Abweichungen in seiner Entwicklung von besonderer Bedeutung für den korrekten Aufbau der Grundlagen der zukünftigen Persönlichkeit des Kindes. Das Problem der Selbstwahrnehmung wird im Rahmen der in- und ausländischen psychologischen Forschung vielfach diskutiert. Das Studium der Struktur des Selbstbewusstseins und der Dynamik seiner Entwicklung ist sowohl theoretisch als auch praktisch von großem Interesse, da es uns ermöglicht, den Mechanismen der Persönlichkeitsbildung in der Ontogenese näher zu kommen. Das Problem des Selbstbewusstseins (Ich-Ich, Ich-Bild, Ich-Konzept) ist derzeit durchaus relevant. Dies liegt an der Notwendigkeit, den Grad der Bedeutung eines Kindes unter modernen Bedingungen sowie seine Fähigkeit zu bestimmen, sich selbst und die Welt um es herum zu verändern.
Selbstwertgefühl kann nicht von alleine, aus dem Nichts entstehen. Es besteht aus den Kommentaren von Erwachsenen, dem Familienklima, der Beziehung zwischen den Eltern, ihren Urteilen über die Charaktereigenschaften und Handlungen des Kindes. Erwachsene beeinflussen die Persönlichkeitsbildung eines Kindes, die Bildung seines Selbstwertgefühls und die Definition seines persönlichen „Ich“.
1. Das Konzept des „Selbstbewusstseins“ und seine Struktur
Selbstbewusstsein ist eine bestimmte Form eines realen Phänomens – Bewusstsein. Selbstbewusstsein setzt die Isolation und Trennung eines Menschen von sich selbst, seinem Ich, von allem, was ihn umgibt, voraus. Selbstbewusstsein ist das Bewusstsein einer Person für ihre Handlungen, Gefühle, Gedanken, Verhaltensmotive, Interessen und ihre Stellung in der Gesellschaft. Bei der Bildung des Selbstbewusstseins spielen die Empfindungen eines Menschen über seinen eigenen Körper, seine Bewegungen und Handlungen eine wichtige Rolle.
Selbstbewusstsein ist auf sich selbst gerichtetes Bewusstsein: Es ist Bewusstsein, das Bewusstsein zu seinem Subjekt, seinem Objekt macht. Wie ist dies aus Sicht der materialistischen Erkenntnistheorie möglich – das ist die zentrale philosophische Frage des Problems des Selbstbewusstseins. Die Frage besteht darin, die Besonderheiten dieser Form des Bewusstseins und der Erkenntnis zu klären. Diese Spezifität wird durch die Tatsache bestimmt, dass sich das menschliche Bewusstsein als subjektive Form der Realität im Akt des Selbstbewusstseins in Subjekt und Objekt, in wissendes Bewusstsein (Subjekt) und bekanntes Bewusstsein (Objekt) spaltet. Eine solche Spaltung ist eine offensichtliche und ständig beobachtete Tatsache, egal wie seltsam sie dem gewöhnlichen Denken erscheinen mag.
Das Problem des Selbstbewusstseins wurde erstmals von L.S. gestellt. Wygotski. Er verstand Selbstbewusstsein als eine genetisch höhere Form des Bewusstseins, als eine Stufe der Bewusstseinsentwicklung, die durch die Entwicklung der Sprache, willkürlicher Bewegungen und das Wachstum der Unabhängigkeit vorbereitet wird. EIN. Leontyev glaubte im Hinblick auf das Selbstbewusstsein, dass man bei der Wahrnehmung einer Person über sich selbst als Individuum zwischen Wissen über sich selbst und Bewusstsein über sich selbst unterscheiden muss. A.G. Spirkin versteht Selbstbewusstsein als das Bewusstsein und die Einschätzung einer Person über ihre Handlungen, ihre Ergebnisse, Gedanken, Gefühle, moralischen Charakter und Interessen, Ideale und Verhaltensmotive, eine ganzheitliche Einschätzung ihrer selbst und ihres Platzes im Leben. I.I. Chesnokova glaubt, dass es bei der Untersuchung des Problems des Selbstbewusstseins wichtig ist, die Beziehung zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein zu klären. Sie ist davon überzeugt, dass es sich um Phänomene einer Ordnung handelt, deren Trennung nur in der Abstraktion möglich ist, weil sie im wirklichen Leben eines Individuums vereint sind: In den Bewusstseinsprozessen ist Selbstbewusstsein in Form von Bewusstsein vorhanden die Zuordnung des Bewusstseinsakts zu meinem Selbst. Der Unterschied zwischen diesen Phänomenen besteht darin, dass, wenn das Bewusstsein auf die gesamte objektive Welt ausgerichtet ist, das Objekt des Selbstbewusstseins die Persönlichkeit selbst ist. Im Selbstbewusstsein fungiert sie sowohl als Subjekt als auch als Objekt des Wissens. Chesnokova gibt die folgende Definition von Selbstbewusstsein: „Selbstbewusstsein ist ein komplexer mentaler Prozess, dessen Kern darin besteht, dass eine Person zahlreiche Bilder von sich selbst in verschiedenen Aktivitäts- und Verhaltenssituationen in allen Formen der Interaktion mit wahrnimmt.“ anderen Menschen und in der Kombination dieser Bilder zu einer einzigen ganzheitlichen Formation – zu einer Darstellung und dann zum Konzept des eigenen Selbst als einem von anderen Subjekten unterschiedenen Subjekt; Bildung eines perfekten, tiefen und angemessenen Selbstbildes.“
In der Psychologie gibt es unterschiedliche Meinungen über die Komponenten, aus denen die Struktur des Selbstbewusstseins besteht. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Konzept von V.S. Muchina. Der zentrale Mechanismus zur Strukturierung des Selbstbewusstseins ist die Identifikation. In der Ontogenese der Persönlichkeit führt die Beherrschung der Identifikation als die Fähigkeit, die eigenen Eigenschaften, Neigungen, Gefühle anderen und die Eigenschaften, Neigungen, Gefühle anderer zuzuschreiben und als die eigenen zu erleben, zur Bildung von Mechanismen des Sozialverhaltens, zur Etablierung von Beziehungen zu einer anderen Person auf einer positiven emotionalen Basis. Die Zuordnung der Struktur des Selbstbewusstseins erfolgt durch den Mechanismus der Identifikation mit einem Namen, mit besonderen Mustern, die Anerkennungsansprüche entwickeln, mit Geschlecht, mit dem Bild von „Ich“ in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mit diesen soziale Werte, die die Existenz des Einzelnen im sozialen Raum sichern. Die Wiedergeburt der Persönlichkeit ist mit der Bildung einer Weltanschauung, mit dem Aufbau eines kohärenten Systems persönlicher Bedeutungen verbunden. Hier wirkt der Identifikationsmechanismus auf emotionaler und kognitiver Ebene. Eine entwickelte Persönlichkeit lässt sich von Ideologie und Weltanschauung leiten und prognostiziert sich selbst in die Zukunft, bildet sich ein Idealbild ihrer Lebensposition, identifiziert sich emotional und rational damit und strebt danach, diesem Bild zu entsprechen.
V.V. Stolin versteht unter Identität das Selbstbewusstsein einer Person, das eine vielschichtige Struktur aufweist und die Identifizierung des Individuums mit seiner sozialen Integrität, Einzigartigkeit und Bedeutung seines Wesens sowie die Bildung und Veränderung von Vorstellungen über seine Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart umfasst. Er betrachtet den Menschen als Subjekt der Aktivität, das seine Aktivität auf verschiedenen Ebenen manifestiert, und glaubt, dass so wie im Lebensprozess eines Organismus ein Körperdiagramm entsteht, so bildet sich auch das Individuum ein Bild von sich selbst (phänomenologisches Selbst), das diesem angemessen ist sein soziales und aktives Dasein. „Der Prozess der Entwicklung des Subjekts selbst, betrachtet unter dem Gesichtspunkt der Entstehung seines phänomenalen Selbst, das wichtige Funktionen in der Aktivität des Subjekts hat, ist der Prozess der Entwicklung seines Selbstbewusstseins.“ Er korreliert die Prozesse des Selbstbewusstseins mit den Aktivitätsebenen eines Menschen als Organismus, Individuum und Persönlichkeit und identifiziert drei Ebenen des Selbstbewusstseins:
I - „...Selbstselektion und Selbstberücksichtigung (in motorischen Handlungen)“; Selbstbewusstsein, Identität, Selbstwertgefühl von Vorschulkindern II – das Selbstbewusstsein des Einzelnen, d. h. Akzeptanz der Sichtweise eines anderen auf sich selbst, Identifikation mit den Eltern, mit Rollen, Bildung von Selbstbeherrschung; III – individuelles Selbstbewusstsein als Identifizierung des eigenen sozialen Wertes und der Bedeutung des Seins, Bildung einer Vorstellung von der eigenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Basierend auf einem solchen mehrstufigen Modell des Selbstbewusstseins, das über die Idee von A.N. nachdenkt. Leontyev über persönliche Bedeutung, V.V. Stolin kommt auf die Idee der Existenz einer Einheit des Selbstbewusstseins – der „Bedeutung des Selbst“, die teilweise mit dem Selbstwertgefühl identisch ist und eine adaptive Funktion in Bezug auf die Aktivität des Subjekts erfüllt. V.V. Stolin glaubt, dass die „Bedeutung des Selbst“ als Beziehung zum Motiv oder Ziel der für ihre Erreichung relevanten Qualitäten des Subjekts erzeugt und im Selbstbewusstsein in Bedeutungen (kognitive Konstrukte) und emotionale Erfahrungen geformt wird. Folglich basiert das Selbstbewusstsein einer Person auf der Lösung innerer Widersprüche, die durch die Realität erzeugt werden, was den dialogischen Charakter des Selbstbewusstseins des Einzelnen bestimmt. Im Prozess zahlreicher interner Dialoge entsteht ein „Bild des Selbst“, wie V.V. Stolin: „Das Selbstbild ist ein Produkt des Selbstbewusstseins.“ Ansichten von V.V. Stolin steht den Gedanken von I.S. nahe. Kona. Nach Ansicht von I.S. Konas Identität (Selbst) ist einer der Aspekte des „Ich“-Problems – „Ego“ (Subjektivität) und „Ich-Bild“. „Ego“ als Regulierungsmechanismus setzt die Kontinuität der geistigen Aktivität und das Vorhandensein von Informationen über sich selbst voraus. Das „Selbstbild“ wird gewissermaßen vervollständigt und zugleich korrigiert. Das Problem des menschlichen Selbst zieht sich wie ein roter Faden durch sein gesamtes Werk. IST. Cohn bemerkt: „Die Reihe mentaler Prozesse, durch die ein Individuum sich selbst als Subjekt einer Aktivität erkennt, wird Selbstbewusstsein genannt, und seine Vorstellungen von sich selbst entwickeln sich zu einem bestimmten „Bild des Selbst“. Laut I.S. Konu, das „Bild des Selbst“ ist das Einstellungssystem der Persönlichkeit, einschließlich der Einstellung zu sich selbst; Bewusstsein und Selbstwertgefühl der eigenen individuellen Eigenschaften und Qualitäten; körperliche Merkmale (Wahrnehmung und Beschreibung des eigenen Körpers und Aussehens). Somit ist das „Bild des Selbst“ die Gesamtheit der Vorstellungen eines Individuums über sich selbst. M.I. Lisina erforscht die Natur der Kommunikation und kommt zu dem Schluss, dass sich in der Kommunikation ein Selbstbild bildet. Es handelt sich um ein affektiv-kognitives Bild, das Einstellungen zu sich selbst (Selbstwertgefühl) und zum Selbstbild umfasst. Laut M.I. Lisina, die Merkmale des Selbstbildes sind zweitrangig, Subjektivität und Verbindung mit der Aktivität des Individuums, das es erzeugt, Selektivität der Reflexion des Originals darin, Dynamik und Variabilität des Bildes, komplexe Architektur der Struktur, komplexe Verbindung mit Die Prozesse des Bewusstseins. M.I. Lisina glaubt, dass die Vorstellung von sich selbst in der Wahrnehmung entsteht, dann wird das Bild der Wahrnehmung im Gedächtnis verarbeitet, angereichert durch visuelles Denken und sogar rein spekulative Schemata. Die Struktur des Selbstbildes besteht aus einem Kern, der Wissen über sich selbst als Subjekt und Persönlichkeit, das allgemeine Selbstwertgefühl enthält, und der Peripherie, in der neues Wissen über sich selbst, spezifische Fakten und privates Wissen angesammelt werden. Die Peripherie wird durch das Prisma des Kerns gebrochen und mit affektiven Komponenten überwuchert. Das Selbstbild ist dynamisch und entwickelt sich ständig weiter. Es verändert sich nicht im Detail, sondern wird qualitativ völlig verändert. M.I. Lisina identifiziert zwei Hauptquellen für die Konstruktion des Selbstbildes: I - Erfahrung individueller menschlicher Aktivität; II – Erfahrung in der Kommunikation mit anderen Menschen. Folglich können wir sagen, dass sich in der Psychologie im allgemeinsten Sinne eine eigentümliche Trias in Bezug auf das Verständnis von Identität entwickelt hat: Bewusstsein – Selbstbewusstsein – Selbstbild Identität kann als Äquivalent von Selbstbewusstsein betrachtet werden. wobei Selbstbewusstsein als eine Reihe mentaler Prozesse verstanden wird, deren Vereinigung, durch die sich eine Person ihrer selbst bewusst wird. Durch das Bewusstsein erhält ein Mensch Vorstellungen über sich selbst, und das ganzheitliche System aller Vorstellungen ist das Selbstbild des Einzelnen. Das Selbstbild ist ein Produkt der Selbstwahrnehmung, einschließlich kognitiver, emotionaler und verhaltensbezogener Komponenten. . Entwicklung des „Ich“-Bildes bei Vorschulkindern Bisher hat die Pädagogik dem Prozess der Bildung des Ich-Bildes eines Kindes nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Basierend auf der Forschung von M.V. Korepanova, unter dem Bild „Ich“ verstehen wir die Gesamtheit der sich entwickelnden Vorstellungen eines Kindes über sich selbst, die mit seinem Selbstwertgefühl verbunden sind und die Wahl der Art und Weise der Interaktion mit der Gesellschaft bestimmen. Bei der Untersuchung der Merkmale der Bildung des „Ich“-Bildes ist es notwendig, die Sensibilität der Zeit der Vorschulkindheit und ihren Einfluss auf die Art der Interaktion des Kindes mit Gleichaltrigen zu berücksichtigen. Moderne Forschungsmaterialien zeigen, dass die Vorstellungen eines Kindes über sich selbst und seine Einstellung zu sich selbst nicht angeboren sind, sondern im Laufe der Kommunikation entstehen. Die Bildung des „Ich“-Bildes eines Kindes hängt vollständig von den Informationen ab, die ihm seine unmittelbare Umgebung liefert: die Welt der Erwachsenen und die Welt der Gleichaltrigen. Im Vorschulalter werden die Vorstellungen eines Kindes über sich selbst in Korrelation mit den Bildern anderer Kinder geformt. Es besteht eine enge Verflechtung zwischen der Erfahrung individueller Aktivität und der Erfahrung der Kommunikation. Das Kind beobachtet andere Kinder neugierig, vergleicht eifersüchtig ihre Leistungen mit seinen eigenen und bespricht mit Interesse seine eigenen Angelegenheiten und die seiner Kameraden mit den Älteren. Allmählich nimmt die Bedeutung der Kommunikation mit Spielpartnern so stark zu, dass es möglich ist, den Prozess der Kommunikation eines Kindes mit Gleichaltrigen als einen der führenden Faktoren für die Entwicklung der Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins hervorzuheben, insbesondere in den ersten sieben Jahren das Leben eines Kindes. Kontakte mit Gleichaltrigen bereichern die Selbsterkenntniserfahrung des Kindes erheblich und vertiefen seine Einstellung zu sich selbst als Handlungssubjekt. Deshalb haben wir uns der Untersuchung des Wesens und der Muster dieses Prozesses zugewandt. Zu diesem Zweck wurde ein Modell des Prozesses der schrittweisen Bildung des „Ich“-Bildes von Vorschulkindern in der Kommunikation mit Gleichaltrigen entwickelt. Die erste Phase war der Selbsterkenntnis durch gemeinsame Spiele und Aktivitäten mit Gleichaltrigen gewidmet, die sich in der Präsenz und Art der Vorstellungen über sich selbst und andere ausdrückten. Für ein Kind ist es wichtig zu verstehen, wie ähnlich es seinen Mitmenschen ist, wie sich diese Ähnlichkeit äußert und ob es gut ist, wie die Kinder um es herum zu sein. Die zweite Stufe zielt darauf ab, durch die Überwindung der Widersprüche zwischen positiver Selbstdarstellung und Beurteilung durch Gleichaltrige eine angemessene Selbstwahrnehmung des Kindes zu entwickeln. Wir glauben, dass ein ganzheitliches Selbstbild nur dann entstehen kann, wenn das Kind lernt, auf seine eigenen Gefühle zu hören und über seine Gefühle und Erfahrungen zu sprechen. Für einen Vorschulkind ist es immer noch schwierig, den engen Zusammenhang zwischen den erlebten Zuständen zu verstehen: Schmerzen lösen in ihm negative Gefühle aus und etwas zu tun, das er liebt, hebt seine Stimmung. Spiele und Trainingsübungen helfen, die innere Welt von Gefühlen und Zuständen zu verstehen, sie zu analysieren und zu verwalten. Die Fähigkeit, seine Gefühle zu reflektieren, ermutigt das Kind, auf die Wünsche anderer Rücksicht zu nehmen und sein Verhalten an allgemein anerkannte Regeln anzupassen. Die dritte Phase war einem Prozess gewidmet, bei dem Vorschulkinder ihr „Ich“ identifizieren und sich mit anderen vergleichen sollten, um einen würdigen Platz in verschiedenen sozialen Beziehungen zu finden. Die Arbeit vorschulischer Bildungseinrichtungen in dieser Phase besteht darin, Vorschulkindern ein neues Maß an Selbstbewusstsein zu vermitteln, das sich in einem ganzheitlichen, wahren Selbstverständnis und der Akzeptanz von sich selbst als einzigartigem, einzigartigem Individuum ausdrückt. Daher ist das Bewusstsein des Kindes für sein „Ich“ ein entscheidender Moment in der ganzheitlichen Entwicklung der Persönlichkeit des Vorschulkindes. Es erscheint notwendig, die Erfahrungen der Selbsterkenntnis von Vorschulkindern in die Inhalte der Vorschulerziehung einzubeziehen, die zur Entwicklung der Selbstständigkeit, des Selbstvertrauens der Kinder und der Ergebnisse ihrer Aktivitäten im Spielraum der Kindergemeinschaft beitragen. 3. Merkmale des Selbstwertgefühls im Vorschulalter. Die Rolle von Erwachsenen bei der Gestaltung des Selbstwertgefühls eines Kindes
Im Vorschulalter sind Beurteilung und Selbstwertgefühl emotionaler Natur. Von den umliegenden Erwachsenen werden diejenigen am positivsten bewertet, für die das Kind Liebe, Vertrauen und Zuneigung empfindet. Ältere Kinder im Vorschulalter bewerten häufiger die Innenwelt der Erwachsenen um sie herum und können so eine tiefere und differenziertere Einschätzung erhalten als Kinder im mittleren und jüngeren Vorschulalter. Ein Vergleich des Selbstwertgefühls eines Vorschulkindes bei verschiedenen Arten von Aktivitäten zeigt einen ungleichen Grad seiner Objektivität („Überschätzung“, „ausreichende Einschätzung“, „Unterschätzung“). Die Richtigkeit des Selbstwertgefühls von Kindern wird maßgeblich von den Besonderheiten der Aktivität, der Sichtbarkeit ihrer Ergebnisse, dem Wissen über ihre Fähigkeiten und Erfahrungen bei deren Bewertung, dem Grad der Aneignung echter Bewertungskriterien in diesem Bereich und dem Niveau der die Wünsche des Kindes in einer bestimmten Aktivität. Daher ist es für Kinder einfacher, eine angemessene Selbsteinschätzung der von ihnen angefertigten Zeichnung zu einem bestimmten Thema abzugeben, als ihre Position im System persönlicher Beziehungen richtig einzuschätzen. Während der gesamten Vorschulkindheit bleibt ein allgemein positives Selbstwertgefühl erhalten, das auf der selbstlosen Liebe und Fürsorge seitens nahestehender Erwachsener basiert. Dies trägt dazu bei, dass Kinder im Vorschulalter dazu neigen, ihre Fähigkeiten zu überschätzen. Die Erweiterung der Tätigkeitsarten, die das Kind beherrscht, führt zur Bildung eines klaren und selbstbewussten spezifischen Selbstwertgefühls, das seine Einstellung zum Erfolg einer bestimmten Handlung zum Ausdruck bringt. Charakteristisch ist, dass das Kind in diesem Alter sein eigenes Selbstwertgefühl von der Selbsteinschätzung anderer trennt. Das Wissen eines Vorschulkindes um die Grenzen seiner Kräfte beruht nicht nur auf der Kommunikation mit Erwachsenen, sondern auch auf seiner eigenen praktischen Erfahrung. Kinder mit überhöhten oder unterschätzten Vorstellungen von sich selbst reagieren empfindlicher auf die bewertenden Einflüsse von Erwachsenen und lassen sich leichter von ihnen beeinflussen . Im Alter von drei bis sieben Jahren spielt die Kommunikation mit Gleichaltrigen eine wichtige Rolle im Prozess der Selbsterkenntnis eines Vorschulkindes. Ein Erwachsener ist ein unerreichbarer Maßstab, und Sie können sich mit Gleichaltrigen auf Augenhöhe vergleichen. Beim Austausch bewertender Einflüsse entsteht eine bestimmte Haltung gegenüber anderen Kindern und gleichzeitig entwickelt sich die Fähigkeit, sich selbst durch deren Augen zu sehen. Die Fähigkeit eines Kindes, die Ergebnisse seiner eigenen Aktivitäten zu analysieren, hängt direkt von seiner Fähigkeit ab, die Ergebnisse anderer Kinder zu analysieren. So entwickelt sich in der Kommunikation mit Gleichaltrigen die Fähigkeit, eine andere Person einzuschätzen, was die Entwicklung eines relativen Selbstwertgefühls anregt. Es drückt die Einstellung des Kindes zu sich selbst im Vergleich zu anderen Menschen aus. Je jünger die Kinder im Vorschulalter sind, desto weniger aussagekräftig sind die Beurteilungen durch Gleichaltrige für sie. Im Alter von drei oder vier Jahren sind die gegenseitigen Einschätzungen der Kinder subjektiver und werden häufiger von ihrer emotionalen Einstellung zueinander beeinflusst. In diesem Alter überschätzt das Kind seine Leistungsfähigkeit, weiß wenig über persönliche Qualitäten und kognitive Fähigkeiten und verwechselt oft konkrete Leistungen mit einer hohen persönlichen Einschätzung. Aufgrund der entwickelten Kommunikationserfahrung im Alter von fünf Jahren kennt das Kind nicht nur seine Fähigkeiten, sondern hat auch eine Vorstellung von seinen kognitiven Fähigkeiten, persönlichen Qualitäten und seinem Aussehen und reagiert angemessen auf Erfolg und Misserfolg. Mit sechs oder sieben Jahren hat ein Vorschulkind eine gute Vorstellung von seinen körperlichen Fähigkeiten, schätzt diese richtig ein und entwickelt eine Vorstellung von seinen persönlichen Qualitäten und geistigen Fähigkeiten. Kinder sind kaum in der Lage, die Handlungen ihrer Kameraden in verschiedenen Situationen zu verallgemeinern und unterscheiden nicht zwischen inhaltlich ähnlichen Eigenschaften. Im frühen Vorschulalter sind positive und negative Peer-Bewertungen gleichmäßig verteilt. Bei älteren Vorschulkindern überwiegen positive Einschätzungen. Kinder im Alter von 4,5 bis 5,5 Jahren sind am anfälligsten für Beurteilungen durch Gleichaltrige. Die Fähigkeit, sich mit Freunden zu vergleichen, erreicht bei Kindern im Alter von fünf bis sieben Jahren ein sehr hohes Niveau. Bei älteren Vorschulkindern hilft die reichhaltige Erfahrung individueller Aktivitäten dabei, den Einfluss von Gleichaltrigen kritisch zu bewerten. Mit zunehmendem Alter wird das Selbstwertgefühl immer korrekter und spiegelt die Fähigkeiten des Kindes besser wider. Zunächst tritt es bei produktiven Aktivitäten und bei Spielen mit Regeln auf, bei denen Sie Ihr Ergebnis klar sehen und mit dem Ergebnis anderer Kinder vergleichen können. Mit echter Unterstützung: einer Zeichnung, einem Entwurf fällt es Vorschulkindern leichter, sich selbst eine richtige Einschätzung zu geben. Allmählich steigt die Fähigkeit von Vorschulkindern, das Selbstwertgefühl zu motivieren, und auch der Inhalt der Motivationen ändert sich. Eine Studie von T. A. Repina zeigt, dass bei Kindern im Alter von drei bis vier Jahren die Tendenz besteht, ihre Werthaltung gegenüber sich selbst eher auf ästhetischen als auf ethischen Reizen zu gründen („Ich mag mich selbst, weil ich schön bin“). Vier- bis fünfjährige Kinder assoziieren Selbstwertgefühl vor allem nicht mit der eigenen Erfahrung, sondern mit der wertenden Haltung anderer: „Ich bin gut, weil der Lehrer mich lobt.“ In diesem Alter besteht der Wunsch, etwas an sich selbst zu verändern, obwohl dies nicht die moralischen Charaktereigenschaften betrifft. Im Alter von 5 bis 7 Jahren rechtfertigen sie ihre positiven Eigenschaften unter dem Gesichtspunkt des Vorhandenseins moralischer Qualitäten. Aber selbst mit sechs oder sieben Jahren können nicht alle Kinder ihr Selbstwertgefühl motivieren. Im siebten Lebensjahr beginnt das Kind, zwei Aspekte des Selbstbewusstseins zu unterscheiden – Selbsterkenntnis und Einstellung zu sich selbst. So beobachtet man beim Selbstwertgefühl: „Manchmal gut, mal schlecht“ eine emotional positive Einstellung sich selbst gegenüber („Ich mag mich“) oder bei einer allgemein positiven Einschätzung: „Gut“ eine verhaltene Einstellung („Ich mag mich“) ein wenig“) beobachtet wird. Im höheren Vorschulalter steigt neben der Zufriedenheit der meisten Kinder mit sich selbst auch der Wunsch, etwas an sich zu verändern, anders zu werden. Im Alter von sieben Jahren vollzieht sich bei einem Kind eine wichtige Veränderung seines Selbstwertgefühls. Es geht vom Allgemeinen zum Differenzierten. Das Kind zieht Rückschlüsse auf seine Leistungen: Es merkt, dass es manche Dinge besser meistert, andere schlechter. Vor dem fünften Lebensjahr überschätzen Kinder meist ihre Fähigkeiten. Und mit 6,5 Jahren loben sie sich selbst selten, obwohl die Tendenz zur Prahlerei bestehen bleibt. Gleichzeitig nimmt die Zahl der fundierten Schätzungen zu. Mit 7 Jahren schätzen die meisten Kinder sich selbst richtig ein und sind sich ihrer Fähigkeiten und Erfolge bei verschiedenen Aktivitäten bewusst. Diese Veränderungen lassen sich zu einem großen Teil durch das Aufkommen des Interesses älterer Vorschulkinder an der inneren Welt der Menschen, ihren Übergang zur persönlichen Kommunikation, die Aneignung wichtiger Kriterien für die Bewertungstätigkeit und die Entwicklung des Denkens und Sprechens erklären. Das Selbstwertgefühl eines Vorschulkindes spiegelt seine sich entwickelnden Gefühle von Stolz und Scham wider. Die Entwicklung des Selbstbewusstseins steht in engem Zusammenhang mit der Bildung der kognitiven und motivierenden Sphäre des Kindes. Aufgrund ihrer Entwicklung stellt sich am Ende der Vorschulzeit eine wichtige Neubildung ein – das Kind erweist sich in besonderer Form als fähig, sich seiner selbst und der Position, die es gerade einnimmt, bewusst zu werden, das heißt, das Kind erwirbt „ Bewusstsein für sein soziales „Ich“ und die Entstehung dieser Grundlage der inneren Position.“ Diese Verschiebung in der Entwicklung des Selbstwertgefühls ist wichtig für die psychologische Bereitschaft eines Vorschulkindes, in der Schule zu lernen, beim Übergang in die nächste Altersstufe. Bis zum Ende der Vorschulzeit nimmt auch die Unabhängigkeit und Kritikalität der Einschätzung und des Selbstwertgefühls der Kinder zu. In der Vorschulkindheit beginnt sich ein weiterer wichtiger Indikator für die Entwicklung des Selbstbewusstseins herauszubilden – das rechtzeitige Bewusstsein für sich selbst. Das Kind lebt zunächst nur in der Gegenwart. Mit der Anhäufung und dem Bewusstsein seiner Erfahrungen wird ihm ein Verständnis seiner Vergangenheit zugänglich. Der älteste Vorschulkind bittet Erwachsene, darüber zu sprechen, wie klein er war, und er selbst erinnert sich gerne an einzelne Episoden der jüngeren Vergangenheit. Es ist charakteristisch, dass das Kind, völlig unbewusst über die Veränderungen, die im Laufe der Zeit in ihm selbst stattfinden, versteht, dass es früher anders war als jetzt: Es war klein, aber jetzt ist es erwachsen. Er interessiert sich auch für die Vergangenheit seiner Lieben. Der Vorschulkind entwickelt die Fähigkeit zur Verwirklichung und das Kind möchte zur Schule gehen, einen Beruf erlernen, wachsen, um bestimmte Vorteile zu erlangen. Das Bewusstsein für die eigenen Fähigkeiten und Qualitäten, die Darstellung seiner selbst in der Zeit, die Entdeckung seiner Erfahrungen – all dies stellt die anfängliche Form des Selbstbewusstseins eines Kindes dar, die Entstehung des persönlichen Bewusstseins. Es erscheint gegen Ende des Schulalters und setzt eine neue Ebene des Bewusstseins für seinen Platz im Beziehungssystem mit Erwachsenen voraus (d. h. jetzt versteht das Kind, dass es noch nicht groß, sondern klein ist). Ein wichtiger Bestandteil des Selbstbewusstseins ist das Bewusstsein der Zugehörigkeit zum männlichen oder weiblichen Geschlecht, also der Geschlechtsidentität. Primäres Wissen darüber entwickelt sich in der Regel im Alter von eineinhalb Jahren. Mit zwei Jahren kann das Baby zwar sein Geschlecht kennen, seine Zugehörigkeit dazu jedoch nicht rechtfertigen. Im Alter von drei oder vier Jahren unterscheiden Kinder klar das Geschlecht ihrer Mitmenschen und kennen ihr Geschlecht, assoziieren es jedoch oft nicht nur mit bestimmten somatischen Eigenschaften und Verhaltenseigenschaften, sondern auch mit zufälligen äußeren Zeichen wie Frisur, Kleidung und Erlaubnis die Möglichkeit, das Geschlecht zu ändern. Im gesamten Vorschulalter sind die Prozesse der sexuellen Sozialisation und sexuellen Differenzierung intensiv. Sie bestehen in der Aneignung von Orientierungen an den Werten des eigenen Geschlechts, in der Aneignung sozialer Bestrebungen, Einstellungen und Verhaltensstereotypen. Nun achtet der Vorschulkind auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen nicht nur im Aussehen, in der Kleidung, sondern auch in ihrem Verhalten. Die Grundlagen für Vorstellungen über Männlichkeit und Weiblichkeit werden gelegt. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen bei den Präferenzen für Aktivitäten, Arten von Aktivitäten und Spielen sowie Kommunikation nehmen zu. Am Ende des Vorschulalters erkennt das Kind die Irreversibilität seines Geschlechts und baut sein Verhalten darauf auf. Die letzte Dimension des „Ich“, die Existenzform des globalen Selbstwertgefühls, ist das Selbstwertgefühl des Einzelnen. Das Selbstwertgefühl ist ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal und es ist ein wichtiges Anliegen des Einzelnen, es auf einem bestimmten Niveau zu halten. Das Selbstwertgefühl eines Menschen wird durch das Verhältnis seiner tatsächlichen Leistungen zu dem, was er zu erreichen behauptet und welchen Zielen er sich setzt, bestimmt. Selbstwertgefühl ist eines der sozialen Gefühle eines Menschen, das mit der Entwicklung einer persönlichen Qualität wie Selbstvertrauen verbunden ist und eine wichtige Rolle bei der Persönlichkeitsbildung eines Kindes spielt. Im Vorschulalter sind Beurteilung und Selbstwertgefühl emotionaler Natur. Von den umliegenden Erwachsenen werden diejenigen am positivsten bewertet, für die das Kind Liebe, Vertrauen und Zuneigung empfindet. Ältere Kinder im Vorschulalter bewerten häufiger die innere Welt der Erwachsenen um sie herum und geben ihnen eine tiefere Einschätzung. Die Selbsteinschätzung eines Vorschulkindes hängt weitgehend von der Einschätzung des Erwachsenen ab. Niedrige Schätzungen wirken sich am negativsten aus. Und überhöhte Werte verzerren die Vorstellungen der Kinder über ihre Fähigkeit, die Ergebnisse zu übertreiben. Gleichzeitig spielen sie aber auch eine positive Rolle bei der Organisation von Aktivitäten und mobilisieren die Kräfte des Kindes. Je genauer der bewertende Einfluss des Erwachsenen ist, desto genauer ist das Verständnis des Kindes für die Ergebnisse seiner Handlungen. Eine ausgeprägte Vorstellung vom eigenen Handeln hilft dem Vorschulkind, den Einschätzungen der Erwachsenen kritisch gegenüberzustehen und sich ihnen teilweise zu widersetzen. Je jünger das Kind ist, desto unkritischer nimmt es die Meinung der Erwachsenen über sich selbst wahr. Ältere Kinder im Vorschulalter interpretieren die Einschätzungen von Erwachsenen durch das Prisma der Einstellungen und Schlussfolgerungen, die ihnen ihre Erfahrung sagt. Ein Kind kann den verzerrenden Bewertungseinflüssen von Erwachsenen bis zu einem gewissen Grad sogar widerstehen, wenn es die Ergebnisse seines Handelns selbstständig analysieren kann. Es ist der Erwachsene, der die Entstehung und Entwicklung evaluativer Aktivitäten beim Kind stimuliert, wenn: es seine Einstellung zur Umwelt und seinen evaluativen Ansatz zum Ausdruck bringt; organisiert die Aktivitäten des Kindes, sorgt dafür, dass bei einzelnen Aktivitäten Erfahrungen gesammelt werden, stellt eine Aufgabe, zeigt Lösungswege auf und bewertet die Leistung; präsentiert Beispiele von Aktivitäten und gibt dem Kind damit Kriterien für die Richtigkeit seiner Umsetzung; organisiert gemeinsame Aktivitäten mit Gleichaltrigen, die dem Kind helfen, eine gleichaltrige Person zu sehen, seine Wünsche zu berücksichtigen, seine Interessen zu berücksichtigen und auch Muster erwachsener Aktivitäten und Verhaltensweisen in Kommunikationssituationen mit Gleichaltrigen zu übertragen (M. I. Lisina, D. B. Godovikova , usw. .). Für die bewertende Tätigkeit muss ein Erwachsener in der Lage sein, im Umgang mit Kindern Freundlichkeit zum Ausdruck zu bringen, ihre Forderungen und Bewertungen zu rechtfertigen, um die Notwendigkeit ersterer zu zeigen, Bewertungen flexibel und ohne Stereotypen zu verwenden und negative Bewertungen durch die Kombination mit vorausschauenden positiven abzumildern. Bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen stärken positive Beurteilungen bewährte Verhaltensweisen und erweitern die Eigeninitiative des Kindes. Und die negativen: Sie strukturieren Aktivitäten und Verhalten neu und konzentrieren sich auf das Erreichen des gewünschten Ergebnisses. Eine positive Bewertung als Ausdruck der Zustimmung anderer verliert in Ermangelung einer negativen Bewertung ihre erzieherische Wirkung, da das Kind den Wert ersterer nicht spürt. Nur eine ausgewogene Kombination positiver und negativer Bewertungen schafft günstige Voraussetzungen für die Ausbildung wertenden und selbstbewertenden Handelns eines Vorschulkindes. Das Vorschulalter zeichnet sich dadurch aus, dass Kinder in diesem Alter großen Wert auf die Einschätzungen der Erwachsenen legen. Das Kind erwartet eine solche Einschätzung nicht, sondern sucht sie aktiv selbst, strebt danach, Lob zu erhalten und bemüht sich sehr, es zu verdienen. Auch im Vorschulalter geben Kinder ihren eigenen Qualitäten ein positives oder negatives Selbstwertgefühl. So sammelt das Kind unter dem Einfluss der Eltern Wissen und Vorstellungen über sich selbst und entwickelt die eine oder andere Art von Selbstwertgefühl. Als günstige Voraussetzung für die Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls können die emotionale Beteiligung der Eltern am Leben des Kindes, unterstützende und vertrauensvolle Beziehungen sowie Beziehungen angesehen werden, die die Entwicklung seiner Unabhängigkeit und die Bereicherung individueller Erfahrungen nicht beeinträchtigen. Abschluss
Das Problem der Selbstwahrnehmung ist eines der schwierigsten in der Psychologie. Der effektivste Weg, dies zu untersuchen, besteht darin, die Entstehung des Selbstbewusstseins zu untersuchen, das hauptsächlich unter dem Einfluss von zwei Hauptfaktoren entsteht – den eigenen praktischen Aktivitäten des Kindes und seinen Beziehungen zu anderen Menschen. Das Vorschulalter gilt als Anfangsstadium der Persönlichkeitsbildung. Das ältere Vorschulalter nimmt in der Kindheit einen besonderen Platz ein. Ein Kind in diesem Alter beginnt, seine Erfahrungen zu erkennen und zu verallgemeinern, es bildet sich eine innere soziale Position, ein stabileres Selbstwertgefühl und eine entsprechende Einstellung zu Erfolg und Misserfolg in der Aktivität. Es gibt eine Weiterentwicklung der Komponente des Selbstbewusstseins – des Selbstwertgefühls. Es entsteht auf der Grundlage von Wissen und Gedanken über sich selbst. Bis zum Ende des Vorschulalters werden das Selbstwertgefühl des Kindes und seine wertenden Urteile über andere allmählich vollständiger, tiefer, detaillierter und erweitert. Merkmale der Entwicklung des Selbstwertgefühls im Vorschulalter: die Erhaltung eines allgemein positiven Selbstwertgefühls; die Entstehung einer kritischen Haltung gegenüber der Selbsteinschätzung bei Erwachsenen und Gleichaltrigen; es entwickelt sich ein Bewusstsein für die eigenen körperlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten, moralischen Qualitäten, Erfahrungen und einige mentale Prozesse; - am Ende des Vorschulalters entwickelt sich Selbstkritik; Fähigkeit, das Selbstwertgefühl zu motivieren. Die Bildung des Selbstbewusstseins, ohne die die Persönlichkeitsbildung nicht möglich ist, ist also ein komplexer und langwieriger Prozess, der die geistige Entwicklung insgesamt charakterisiert. Es entsteht unter dem direkten Einfluss anderer, vor allem Erwachsener, die ein Kind großziehen. Die Kommunikation des Kindes mit Erwachsenen ist für die Entstehung des Selbstwertgefühls in den ersten Phasen der Persönlichkeitsentwicklung (Ende der frühen, Beginn der Vorschulzeit) von entscheidender Bedeutung. Referenzliste
1. Ankudinova N. E. Zur Entwicklung des Selbstbewusstseins bei Kindern / Psychologie eines Vorschulkindes: Leser. Komp. G.A. Uruntaeva. M.: „Akademie“, 2000.- 2. Belkina V. N. Psychologie der frühen und Vorschulkindheit / Lehrbuch - Jaroslawl, 1998. -248 S. Bolotova A.K. Entwicklung des persönlichen Selbstbewusstseins: Zeitlicher Aspekt // Fragen der Psychologie. - 2006, Nr. 2. - S. 116 - 125. Volkov B. S. Vorschulpsychologie: Geistige Entwicklung von der Geburt bis zur Schule: ein Lehrbuch für Universitäten / B. S. Volkov, N.V. Wolkowa. - Ed. 5., überarbeitet und zusätzlich - M.: Academic Project, 2007.- 287 S.- (Gaudemus). Garmaeva T.V. Merkmale der emotionalen Sphäre und des Selbstbewusstseins im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung eines Vorschulkindes // Psychologin im Kindergarten. - 2004, Nr. 2. - C 103-111. 7.Zaporozhets A.V. Zur Psychologie von Kindern im Früh- und Vorschulalter. - M., 1969. Zinko E.V. Zusammenhang zwischen den Merkmalen des Selbstwertgefühls und dem Niveau der Ambitionen. Teil 1. Selbstwertgefühl und seine Parameter // Psychological Journal. - 2006. Band 27, Nr. 3. Maralov V.G. Grundlagen der Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung: Lehrbuch für Studierende. Durchschn. Päd. Lehrbuch Betriebe. - M.: Verlagszentrum „Akademie“, 2002 Nemov R.S. Psychologie: Lehrbuch für höhere Studierende. Päd. Lehrbuch Institutionen: In 3 Büchern - Buch. 3: Psychodiagnostik. Einführung in die wissenschaftliche psychologische Forschung mit Elementen der mathematischen Statistik – 3. Aufl. – M.: Humanit. Ed. VLADOS-Zentrum, 1998 Uruntaeva GA. Vorschulpsychologie. - M.: „Akademie“, 1998.