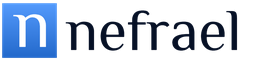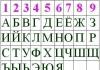Unter einer sozialen Rolle versteht man ein bestimmtes Verhaltensmuster, an das sich eine Person halten muss. Diese Rolle wird durch seinen Status, das Vorhandensein von Pflichten und Rechten bestimmt.
Im Allgemeinen bezeichnet eine soziale Rolle die Zugehörigkeit einer Person zu einer bestimmten Gruppe. Daher gehören Erwachsene und Jugendliche unterschiedlich dazu soziale Gruppen. Aber beide haben möglicherweise eine Reihe gemeinsamer Verantwortlichkeiten und ihre soziale Rolle kann übereinstimmen.
Was sind die Unterschiede zwischen einem Erwachsenen und einem Teenager?
Als Jugendlicher gilt eine Person unter 18 Jahren. Wenn er dieses Alter erreicht, gilt eine Person als erwachsen. Das heißt, er trägt alle Verantwortungen eines Erwachsenen und wird als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft mit allen Verantwortungen wahrgenommen.
Als voll geschäftsfähig gilt das Alter von 18 Jahren. Dies ist ein juristischer Begriff, der bedeutet, dass eine Person das Recht hat, Eigentum zu besitzen und darüber zu verfügen, vor dem Gesetz für ihre Handlungen verantwortlich ist, eine Familie gründen kann und verpflichtet ist, sich um sie zu kümmern.
Bis zum Alter von 18 Jahren ist eine Person nicht voll geschäftsfähig, da ihr Vermögen von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten verwaltet wird, sie nicht in eigenem Namen vor Gericht sprechen kann usw.
Welche soziale Rolle ist für einen Erwachsenen und einen Teenager gleich?
Trotz der Unterschiede lassen sich mehrere soziale Rollen identifizieren, die für Erwachsene und Jugendliche gleichermaßen charakteristisch sind:
- Pflicht zur Einhaltung des Gesetzes. Diese soziale Rolle gilt sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene. Niemand hat das Recht, das Gesetz zu brechen. Jeder Übertreter wird bestraft;
- Sowohl Erwachsene als auch Jugendliche haben die gleiche Pflicht, für ihre behinderten Eltern zu sorgen;
- Einer noch soziale Rolle, sollte der Schulungsbedarf erwähnt werden. Zum Beispiel hat ein Erwachsener das Recht zu studieren, und ein Teenager hat eine solche Pflicht.
Im Allgemeinen können sich die sozialen Verantwortlichkeiten von Erwachsenen und Jugendlichen in vielen anderen Situationen überschneiden. Dabei geht es darum, die gleichen Ziele zu erreichen, Beziehungen zu geliebten Menschen aufzubauen und seinen Verpflichtungen nachzukommen. Daher kann es unendlich viele soziale Rollen geben. Wenn die Ziele übereinstimmen, wird die soziale Rolle gemeinsam sein.
Die Stellung einer Person im sozialen Gefüge einer Gruppe oder Gesellschaft beeinflusst vor allem sein Verhalten. Wenn Sie wissen, welche soziale Ebene (Position in der Gesellschaft) eine Person einnimmt, können Sie die meisten Eigenschaften, die sie besitzt, leicht bestimmen und die Handlungen vorhersagen, die sie ausführen wird.
Ein solches erwartetes Verhalten einer Person, das mit dem Status verbunden ist, den sie hat, wird üblicherweise als bezeichnet soziale Rolle . Eine soziale Rolle stellt eigentlich ein bestimmtes Verhaltensmuster dar, das für Menschen als angemessen anerkannt wird diesen Status in einer bestimmten Gesellschaft. Tatsächlich stellt die Rolle ein Modell dar, das genau zeigt, wie sich eine Person in einer bestimmten Situation verhalten sollte.
Jeder Mensch hat nicht eine, sondern eine ganze Reihe sozialer Rollen, die er in der Gesellschaft spielt. Ihre Kombination wird als Rollensystem bezeichnet. Eine solche Vielfalt sozialer Rollen kann zu inneren Konflikten des Einzelnen führen (wenn einige der sozialen Rollen einander widersprechen).
Wissenschaftler bieten verschiedene Klassifikationen sozialer Rollen an. Zu letzteren zählen in der Regel die sogenannten gesellschaftlichen Hauptrollen. Diese beinhalten:
a) die Rolle eines Arbeitnehmers;
b) die Rolle des Eigentümers;
c) die Rolle des Verbrauchers;
d) die Rolle eines Bürgers;
d) die Rolle eines Familienmitglieds.
Im Jugendalter übernimmt eine Person folgende Rollen:
Ein Schüler, ein Student – er ist ein Student;
Ein Sohn oder eine Tochter, ein Enkel – er hat eine Familie, Eltern;
Sportler - Mitglied Sportteil usw.
Dieses Alter ist geprägt von jugendlichem Maximalismus, Selbstbestätigung und Jugendslang.
Die Beherrschung einer Reihe von Rollen durch die Assimilation von Verhaltensmustern, sozialen Normen und spirituellen Werten trägt zu seiner Sozialisierung als Teilnehmer an sozialen Beziehungen bei.
Obwohl das Verhalten eines Individuums weitgehend von seinem Status und seinen Rollen in der Gesellschaft bestimmt wird, behält es (das Individuum) dennoch seine Autonomie und verfügt über eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Und obwohl in moderne Gesellschaft Es besteht eine Tendenz zur Vereinheitlichung und Standardisierung der Persönlichkeit; eine völlige Nivellierung findet glücklicherweise nicht statt. Ein Mensch hat die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von sozialen Status und Rollen, die ihm die Gesellschaft bietet, zu wählen, die es ihm ermöglichen, seine Pläne besser zu verwirklichen und seine Fähigkeiten so effektiv wie möglich einzusetzen. Die Akzeptanz einer bestimmten sozialen Rolle durch eine Person wird davon beeinflusst, wie soziale Umstände, und seine biologischen und persönliche Eigenschaften(Gesundheitszustand, Geschlecht, Alter, Temperament usw.). Alle Rollenvorgaben nur in Umrissen allgemeines Schema menschliches Verhalten, das dem Einzelnen die Möglichkeit gibt, eine Auswahl an Möglichkeiten zu treffen, um es selbst zu erfüllen.
Im Prozess der Erlangung eines bestimmten Status und der Erfüllung der entsprechenden sozialen Rolle kann es zu einem sogenannten Rollenkonflikt kommen. Bei einem Rollenkonflikt handelt es sich um eine Situation, in der eine Person mit der Notwendigkeit konfrontiert ist, die Anforderungen zweier oder mehrerer inkompatibler Rollen zu erfüllen.
Wir alle erinnern uns natürlich an Fonvizins unsterbliche Mitrofanushka, deren Name seit langem ein Begriff ist, und an Puschkins Grinev aus „Die Tochter des Kapitäns“. Beide sind „unterwuchert“, und wenn dieses Wort heute zumindest abfällig klingt, dann im 18.-19. Jahrhundert.
Es handelte sich lediglich um eine Bezeichnung des sozialen Status, der teilweise vom Alter bestimmt wurde. Sie nannten mich einen Minderjährigen junger Mann, der die Obhut seiner Eltern noch nicht verlassen hat. Ein junger Mann hätte genau die gleiche Position einnehmen können ...
Status bezieht sich auf den Rang, den Wert oder das Ansehen einer Person innerhalb einer Gruppe, Organisation oder Gesellschaft. Der Status spiegelt die hierarchische Struktur einer Gruppe wider und schafft eine vertikale Differenzierung, so wie Rollen verschiedene Berufe trennen.
Dies ist eine weitere Möglichkeit, die Unsicherheit zu verringern und klarzustellen, was von uns erwartet wird.
Merkmale des Status.
Ebenso wie Rollen und Normen existiert auch der Status sowohl innerhalb als auch außerhalb der organisatorischen Umgebung. Im weitesten Sinne nennen wir es sozial...
Ich möchte darauf hinweisen, dass sich niemand, kein Wesen, um schmutzige Energie kümmert. Die Energie der Schöpfung ist erfüllt vom Licht des reinen Bewusstseins, frei von Zweifeln, Wut und anderen negativen Manifestationen schmutziger/dunkler Energie.
Sobald also jemand eine gute Tat beschließt, kommen die Menschen wie die Fliegen zu ihm ...
Beachten wir zunächst, dass sich die Psychologie mit real existierenden sozialen Zusammenhängen beschäftigt, d.h. erforscht psychologische Merkmale, Muster realer Gruppen, in denen Menschen zusammenkommen, durch ein gemeinsames Merkmal, eine gemeinsame Aktivität vereint, in identischen Bedingungen untergebracht und sich in gewisser Weise ihrer Zugehörigkeit zu dieser Formation bewusst sind.
Gleichzeitig wurde die überwiegende Zahl sozialpsychologischer Studien auf dem Material der sogenannten Kleinen durchgeführt...
Eindruck
Normalerweise basiert unsere Wahrnehmung eines anderen Menschen auf der Suche nach Eindrücken, die die Hauptmerkmale seiner Persönlichkeit widerspiegeln. Einmal manifestiert, ermöglichen uns diese Eigenschaften, verschiedene Handlungen einer Person zu erklären und sie mit dem Eindruck von ihr in Einklang zu bringen. In einem Experiment.
In Aschs (1946) Studie wurde eine Person, die objektiv als „intelligent, geschickt, fleißig, entscheidungsfreudig, praktisch und umsichtig“ beschrieben wurde, von einer Versuchsperson als zu kalt beschrieben …
Je nach Entwicklung ist es durch die Vermittlung emotionaler Inhalte und das Vorhandensein von Werten gemeinsamer Aktivitäten zum Überleben möglich, die Schichtungen, Schichten von Gruppen aufgrund des hierarchischen Gesetzes entsprechend der wertinterpretierenden Struktur der Gesellschaft zu bestimmen und die emotionale Färbung kultureller und historischer Schichten.
Emotionen können aus kulturpsychologischer Sicht als die höchsten mentalen Funktionen des Bewusstseins angesehen werden, die alle relevanten...
Es ist viel wichtiger und vorrangiger, materielle Sicherheit und Stabilität zu schaffen, einfach einen anständigen Job zu haben und in der Gesellschaft Gewinn zu erzielen, wenn nicht Erfolg und Respekt, dann zumindest keine Verurteilung und Ablehnung. Es sind jedoch gerade die „sekundären“, nicht lebenswichtigen Bedürfnisse, die das gesellschaftliche Wachstum bestimmen.
Und über diesen „Überschuss“ werden wir sprechen. Im Kontext von „Brot und Spielen“ ist das ein „Spektakel“! Dies ist ein Schwanz, auf den Sie verzichten können. Aber wie! man kann mit einem Schwanz (zum Beispiel einem Pfau) leben, besonders wenn...
Es ist notwendig zu verstehen, wie eine Person mit der Gesellschaft im Besonderen und dem Universum im Allgemeinen interagiert. Dabei haben wir uns am „deutschen Gesellschaftsmodell“ orientiert, das heißt, wir haben die gestellten Aufgaben aus der Sicht der kabbalistischen Theorie betrachtet.
Frage 1: Sind Menschen einfach kluge Tiere, oder bildet die soziale Interaktion, das ständige Bedürfnis, miteinander zu kooperieren, bei ihnen besondere geistige Eigenschaften aus, die Tieren nicht innewohnen?
Weder das eine noch das andere noch das dritte. Das heißt, sind Menschen...
Man kann sich kaum eine teuflischere Bestrafung vorstellen (wenn eine solche Bestrafung physisch möglich wäre), als wenn jemand in einer Gesellschaft von Menschen landete, in der er völlig ignoriert wurde ...
§ 3. Sozialer Status der Jugend
Grundlegendes Konzept. Jugend und Jugend werden immer als Übergang und kritisch interpretiert. Aber was bedeutet „kritische Phase“?
In der Biologie und Psychophysiologie sind kritische oder sensible Perioden jene Phasen der Entwicklung, in denen der Körper durch eine erhöhte Sensibilität (Sensibilität) gegenüber einigen genau definierten äußeren oder inneren Faktoren gekennzeichnet ist, deren Auswirkungen in diesem (und keinem anderen) besonders bedeutsam sind ) Punkt der Entwicklung.
In der Soziologie und anderen Sozialwissenschaften entspricht dies teilweise dem Konzept sozialer Übergänge, Wendepunkten in der Entwicklung, die die Position, den Status oder die Struktur der Aktivität eines Individuums (z. B. den Beginn) radikal verändern Arbeitstätigkeit oder Heirat): Sie werden oft durch besondere Rituale, „Initiationsriten“, formalisiert.
Da sensible Phasen und soziale Übergänge oft mit psychischen Spannungen und Umstrukturierungen einhergehen, gibt es in der Entwicklungspsychologie ein besonderes Konzept – altersbedingte Krisen, mit denen ein Zustand mehr oder weniger ausgeprägter Konflikte verbunden ist. Um zu betonen, dass diese Zustände, egal wie komplex und schmerzhaft sie auch sein mögen, natürlich, statistisch normal und vorübergehend sind, werden sie „normative Lebenskrisen“ genannt, im Gegensatz zu „nicht-normativen Lebenskrisen“ und Ereignissen, bei denen dies nicht der Fall ist folgen nicht der normalen Entwicklungslogik, sondern einigen besonderen, zufälligen Umständen (zum Beispiel dem Tod der Eltern).
Normative Lebenskrisen und die dahinter stehenden biologischen oder sozialen Veränderungen sind sich wiederholende, natürliche Prozesse. Wenn man die relevanten biologischen und sozialen Gesetze kennt, kann man ziemlich genau vorhersagen, in welchem Alter der „durchschnittliche“ Mensch einer bestimmten Gesellschaft die eine oder andere Lebenskrise erleben wird und welche typischen Lösungsmöglichkeiten es gibt. Doch wie ein konkreter Mensch auf diese „Herausforderung“ des Lebens reagieren wird, kann die Wissenschaft nicht sagen.
Der Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter. Der Lebensweg eines Individuums ist wie die Geschichte der Menschheit einerseits ein naturgeschichtlicher, natürlicher Prozess und andererseits ein einzigartiges Drama, jede Szene Das ist das Ergebnis der Zusammenhalt vieler individuell einzigartiger Charaktere und Lebensereignisse. Wiederkehrende Struktureigenschaften von Lebensereignissen können objektiv erfasst werden. Aber die persönliche Bedeutung, das Maß für das Schicksal eines Ereignisses, hängt von vielen spezifischen Gründen ab.
Bei der Beurteilung der Auswirkungen bestimmter Lebensereignisse auf eine Person achtet das gewöhnliche Bewusstsein in erster Linie auf die Helligkeit, die Dramatik der Ereignisse, ihre chronologische Nähe zum Moment der vermeintlichen Persönlichkeitsveränderung im großen Maßstab (das Wort „Ereignis“ selbst). impliziert etwas Bedeutendes, nicht ganz Gewöhnliches) und relative Einheit, Integrität, die es einfach und einmalig aussehen lässt. Aber tiefgreifende persönliche Veränderungen werden nicht immer durch die auffälligsten, dramatischsten und jüngsten Ereignisse verursacht.
Viele psychologische Veränderungen sind das Ergebnis der Anhäufung vieler kleiner Ereignisse und Eindrücke über einen bestimmten Zeitraum und nicht eines großen Ereignisses, und die potenziellen Auswirkungen der kumulativen Interaktion verschiedener Arten von Lebensereignissen müssen berücksichtigt werden. Um beispielsweise Veränderungen im Selbstbild eines Teenagers zu verstehen, sind nicht nur Veränderungen in seinem körperlichen Erscheinungsbild und psychohormonellen Prozessen wichtig, sondern auch ein scheinbar äußeres, zufälliges Ereignis wie der Wechsel in eine neue Schule, das eine Anpassung erforderlich macht zu einem neuen Team, das Bedürfnis, sich selbst mit den Augen neuer Kameraden zu sehen usw.
Unsere Lebensumstände, Handlungen, Erfahrungen und deren Bewusstsein sind oft zeitlich verstreut. Zusätzlich zu dem offensichtlichen Verhalten, das anderen bekannt ist, hat jeder Mensch eine geheime innere Welt, in der unsichtbare, aber sehr wichtige verborgene Ereignisse stattfinden, die nicht nur vor anderen, sondern manchmal auch vor der Person selbst verborgen sind.
Der objektive Prozess der Multidimensionalität und Multivarianz der menschlichen Entwicklung umfasst Ontogenese, Sozialisation und kreative Lebenssuche. In gewisser Weise lassen sie sich irgendwie „mittelmäßig“ darstellen, indem man sagt, dass der Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter im Allgemeinen das Alter von 11-12 bis 23-25 Jahren umfasst und in drei Phasen unterteilt ist.
Die Adoleszenz, die Adoleszenz (von 11-12 bis 14-15 Jahren) ist vor allem im biologischen Sinne ein Übergangsalter, da dies das Alter der Pubertät ist, parallel zu dem andere biologische Systeme des Körpers im Allgemeinen ihre Reife erreichen. In sozialer Hinsicht ist die Teenagerphase eine Fortsetzung der primären Sozialisation. Alle Jugendlichen in diesem Alter sind Schulkinder, die von ihren Eltern oder dem Staat abhängig sind. Sozialer Status Ein Teenager unterscheidet sich nicht viel von einem Kind. Psychologisch ist dieses Alter äußerst widersprüchlich. Es zeichnet sich durch maximale Missverhältnisse im Entwicklungsniveau und -tempo aus. Das „Gefühl des Erwachsenseins“ im Teenageralter stellt vor allem eine neue Ebene des Strebens dar, die eine Position vorwegnimmt, die der Teenager tatsächlich noch nicht erreicht hat. Daher die typischen altersbedingten Konflikte und deren Auswirkung auf das Selbstbewusstsein eines Teenagers. Im Allgemeinen ist dies die Zeit des Endes der Kindheit und des Beginns des „Herauswachsens“.
Die frühe Adoleszenz (von 14-15 bis 18 Jahren) ist im wahrsten Sinne des Wortes die „Dritte Welt“, die zwischen Kindheit und Erwachsenenalter liegt. Biologisch gesehen ist dies die Zeit des Abschlusses der körperlichen Reifung. Die meisten Mädchen und ein erheblicher Teil der Jungen beginnen bereits nach der Pubertät; ihr obliegt die Aufgabe zahlreicher „letzter Handgriffe“ und der Beseitigung von Ungleichgewichten, die durch ungleichmäßige Reifung entstehen. Am Ende dieses Zeitraums sind die wesentlichen Prozesse der biologischen Reifung in den meisten Fällen abgeschlossen, so dass weitere körperliche Entwicklung können als bereits dem Erwachsenenalter zugehörig angesehen werden.
Der soziale Status der Jugend ist heterogen. Die Jugend ist die letzte Phase der primären Sozialisation. Die überwiegende Mehrheit der Jungen und Mädchen sind noch Studenten; ihre Teilnahme an der produktiven Arbeit wird oft nicht nur und nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt ihrer wirtschaftlichen Effizienz, sondern unter dem Gesichtspunkt der Bildung betrachtet. Berufstätige Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren (in manchen Rechtsakten werden sie als „Jugendliche“ bezeichnet) haben einen besonderen Rechtsstatus und genießen eine Reihe von Vorteilen (verkürzte Arbeitszeit, Vollvergütung, Verbot von Überstunden und Nacht- und Wochenendarbeit, Urlaub). Dauer eines Kalendermonats usw.). Gleichzeitig erwerben das Aktivitäts- und Rollengefüge des Einzelnen in diesem Stadium bereits eine Reihe neuer, erwachsener Qualitäten. Die wichtigste gesellschaftliche Aufgabe dieses Zeitalters ist die Berufswahl. Die Allgemeinbildung wird durch Sonder- und Berufsbildung ergänzt. Die Berufswahl und die Art der Bildungseinrichtung differenzieren zwangsläufig die Lebenswege von Jungen und Mädchen mit allen daraus resultierenden sozialen und psychologischen Konsequenzen. Das Spektrum gesellschaftspolitischer Rollen und damit verbundener Interessen und Verantwortlichkeiten erweitert sich.
Der intermittierende soziale Status und Status der Jugend bestimmt auch einige Merkmale ihrer Psyche. Junge Männer sind immer noch zutiefst besorgt über Probleme, die sie aus der Adoleszenz geerbt haben – ihre eigene Altersspezifität, das Recht auf Autonomie gegenüber den Älteren usw. Aber soziale und persönliche Selbstbestimmung setzt nicht so viel Autonomie gegenüber Erwachsenen voraus, sondern eine klare Orientierung und Bestimmung des eigenen Platzes in der Welt der Erwachsenen. Zusammen mit der Differenzierung geistige Fähigkeiten und Interessen, ohne die es schwierig ist, einen Beruf zu wählen; dies erfordert die Entwicklung integrativer Mechanismen der Selbsterkenntnis, die Entwicklung einer Weltanschauung und Lebensposition.
Die Selbstbestimmung der Jugend ist eine äußerst wichtige Phase der Persönlichkeitsbildung. Aber solange diese „vorausschauende“ Selbstbestimmung nicht in der Praxis erprobt ist, kann sie nicht als dauerhaft und endgültig angesehen werden. Daher der dritte Zeitraum von 18 bis 23-25 Jahren, der bedingt als späte Adoleszenz oder frühes Erwachsenenalter bezeichnet werden kann.
Im Gegensatz zu einem Teenager, der im Grunde immer noch der Welt der Kindheit angehört (egal, was er selbst darüber denkt), und einem jungen Mann, der eine Zwischenstellung zwischen einem Kind und einem Erwachsenen, einem 18- bis 23-jährigen Menschen, einnimmt ist sowohl biologisch als auch sozial erwachsen. Die Gesellschaft sieht ihn nicht mehr als Objekt der Sozialisierung, sondern als verantwortliches Subjekt gesellschaftlicher und produktiver Tätigkeit, das seine Ergebnisse nach „erwachsenen“ Maßstäben bewertet. Mittlerweile wird die Arbeit zum führenden Betätigungsfeld, was zu einer Differenzierung der Berufsrollen führt. Über diese Altersgruppe kann nicht mehr „allgemein“ gesprochen werden: Ihre sozialpsychologischen Eigenschaften hängen weniger vom Alter als vielmehr vom sozio-professionellen Status ab. Die in diesem Entwicklungsstadium andauernde Ausbildung ist nicht mehr allgemeiner, sondern spezieller, beruflicher Art, und beispielsweise kann das Studium an einer Universität selbst als eine Art Arbeitstätigkeit angesehen werden. Junge Menschen erlangen mehr oder weniger große finanzielle Unabhängigkeit von ihren Eltern und gründen ihre eigenen Familien.
Der polnische humanistische Lehrer Janusz Korczak steht der heutigen Psychologie sehr nahe: „Ich weiß und kann nicht wissen, wie mir unbekannte Eltern unter mir unbekannten Bedingungen ein mir unbekanntes Kind großziehen können, ich betone: „Sie können.“ „und nicht „sie wollen“ und nicht „sie müssen“.
In „Ich weiß nicht“ herrscht für die Wissenschaft urtümliches Chaos, die Geburt neuer Gedanken, die der Wahrheit immer näher kommen. „Ich weiß nicht“ ist eine schmerzhafte Leere für einen Geist, der im wissenschaftlichen Denken unerfahren ist.“1
Psychologische Aspekte der Sozialisation. Die Adoleszenz ist im Vergleich zur Adoleszenz durch eine stärkere Differenzierung emotionaler Reaktionen und Ausdrucksweisen gekennzeichnet emotionale Zustände sowie eine erhöhte Selbstkontrolle und Selbstregulierung. Dennoch „gehören zu den allgemeinen Verantwortlichkeiten dieses Zeitalters Stimmungsschwankungen mit Übergängen von ungezügelter Freude zu Verzweiflung und eine Kombination aus einer Reihe polarer Qualitäten, die abwechselnd auftreten.“ Dazu gehört eine besondere Sensibilität des Teenagers für die Einschätzung seines Aussehens, seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten durch andere und damit einhergehend ein übermäßiges Selbstvertrauen und übermäßige Kritik an anderen. Subtile Sensibilität koexistiert manchmal mit erstaunlicher Gefühllosigkeit, schmerzhafte Schüchternheit mit Schlamperei, der Wunsch, von anderen anerkannt und geschätzt zu werden, mit betonter Unabhängigkeit, der Kampf gegen die Autorität mit der Vergöttlichung beliebiger Idole, sinnliche Fantasie mit trockenem Philosophieren.“2
Natürlich ist zu bedenken, dass diese Beschreibung von einem Psychiater stammt, der beruflich dazu neigt, vor allem schmerzhafte Merkmale hervorzuheben, und dass sie sich auf die gesamte Zeit der Pubertät, einschließlich der „schwierigen“ Pubertät, erstreckt. In der Jugend werden einige der aufgeführten Schwierigkeiten bereits gemildert und abgeschwächt. Wenn wir jedoch 15- bis 18-jährige Jungen mit Erwachsenen vergleichen, wird diese Beschreibung im Allgemeinen richtig sein und mit zahlreichen autobiografischen, tagebuchbezogenen und künstlerischen Selbstbeschreibungen übereinstimmen, in denen die Motive innerer Widerspruch, Langeweile, Einsamkeit, Depression usw. variieren endlos.
Obwohl der Grad der bewussten Selbstkontrolle bei jungen Männern viel höher ist als bei Heranwachsenden, klagen sie am häufigsten über Willensschwäche, Instabilität, Anfälligkeit gegenüber äußeren Einflüssen und charakterologische Merkmale wie Launenhaftigkeit, Unzuverlässigkeit und Empfindlichkeit. Vieles in ihrem Leben, einschließlich ihrer eigenen Handlungen, scheint automatisch zu geschehen, gegen ihren Willen und sogar im Gegensatz dazu. „Manchmal möchte man einer Person aufrichtig antworten – bam! - ein idiotischer, verächtlicher Spott fliegt bereits aus seinem Mund. Alles wird dumm ...“ (Aus der Geschichte eines 18-jährigen Jungen).
Sogenannte unmotivierte Handlungen kommen häufig vor Jugend, sind keineswegs unvernünftig. Es ist nur so, dass ihre Motive aufgrund bestimmter Umstände vom Teenager nicht erkannt werden und einer logischen Analyse nicht zugänglich sind. Um sie zu verstehen, „ist es notwendig, klar zwischen der Spannung und oft dem inneren Konflikt der Psyche des Jugendlichen und dem sozialen Verhaltenskonflikt zu unterscheiden.“3
Viele Hobbys der Jugend erscheinen älteren Menschen oft irrational. Auch wenn ihr Thema völlig unschuldig und positiv ist, sind Erwachsene verwirrt und irritiert von jugendlicher Besessenheit, Fremdheit („Na, ist es möglich, wegen mancher Marken oder CDs verrückt zu werden?“) und Einseitigkeit: sich von einer Sache mitreißen zu lassen, Ein junger Mann bringt oft andere Angelegenheiten auf den Weg, die aus der Sicht der Älteren wichtiger sind.
Solche Behauptungen sind oft unbegründet und psychologisch naiv. Ehrlich gesagt ist es unmöglich, Lehrer und Eltern zufrieden zu stellen. Wenn sich ein Teenager zu etwas hinreißen lässt, wird ihm Einseitigkeit vorgeworfen. Wenn er sich für nichts interessiert, was für die meisten Teenager typisch ist, wird ihm Passivität und Gleichgültigkeit vorgeworfen. Wenn die Hobbys eines Teenagers wechselhaft und kurzfristig sind, wird ihm Oberflächlichkeit und Frivolität vorgeworfen. Wenn sie jedoch stabil und tiefgründig sind, aber nicht mit den Vorstellungen der Eltern über das Wünschenswerte und Richtige übereinstimmen, versuchen sie ihn auf jede erdenkliche Weise abzulenken oder ihn von ihnen wegreißen.
Ohne sich die Mühe zu machen, sich mit den tiefen psychologischen Bedürfnissen des Einzelnen zu befassen, die dieses oder jenes Hobby befriedigt, übertragen ältere Menschen gedankenlos und gewaltsam die Verantwortung für alle realen und eingebildeten Gefahren und Kosten von Teenager-Hobbys zu ihrem Thema, sei es Rockmusik oder ein anderes Motorrad. Aber die Hauptsache ist nicht das Subjekt der Leidenschaft, sondern ihre psychologischen Funktionen und Bedeutung für das Subjekt. Emotionen können ebenso wie Denkprozesse nicht verstanden werden, ohne das Selbstbewusstsein des Einzelnen zu berücksichtigen.
Die wichtigste psychologische Errungenschaft der frühen Jugend ist die Entdeckung der eigenen inneren Welt. Für ein Kind ist die einzige bewusste Realität die Außenwelt, in die es seine Vorstellungskraft projiziert. Er ist sich seiner Handlungen voll bewusst, seiner eigenen ist er sich jedoch noch nicht bewusst mentale Zustände. Wenn ein Kind wütend ist, erklärt es es damit, dass jemand es beleidigt hat; wenn es glücklich ist, dann gibt es dafür auch objektive Gründe. Für einen jungen Mann ist die äußere, physische Welt nur eine der Möglichkeiten subjektiver Erfahrung, deren Mittelpunkt er selbst ist. Dieses Gefühl wurde von einem 15-jährigen Mädchen gut zum Ausdruck gebracht, als es von einem Psychologen gefragt wurde: „Welches Ding erscheint Ihnen am realsten?“ antwortete: „Ich selbst.“
Psychologen haben wiederholt verschiedene Länder und in verschiedenen sozialen Umgebungen forderten sie Kinder unterschiedlichen Alters auf, eine unvollendete Geschichte nach ihrem eigenen Verständnis zu vervollständigen oder eine Geschichte basierend auf einem Bild zu verfassen. Das Ergebnis ist mehr oder weniger das gleiche: Kinder und jüngere Teenager beschreiben in der Regel Handlungen, Aktionen, Ereignisse, ältere Teenager und junge Männer beschreiben hauptsächlich die Gedanken und Gefühle der Charaktere. Der psychologische Inhalt der Geschichte beunruhigt sie mehr als der äußere „Ereignis“-Kontext.
Durch die Fähigkeit, in seine Erlebnisse einzutauchen, entdeckt der junge Mann eine ganze Welt neuer Emotionen, die Schönheit der Natur und die Klänge der Musik. Diese Entdeckungen geschehen oft plötzlich, wie durch eine Inspiration: „Vorbeigehen Sommergarten„Mir fiel plötzlich auf, wie schön sein Kühlergrill ist“; „Gestern habe ich nachgedacht und plötzlich hörte ich Vogelgesang, den ich vorher nicht bemerkt hatte“; Ein 14- bis 15-jähriger Mensch beginnt, seine Emotionen nicht mehr als Ableitungen einiger äußerer Ereignisse wahrzunehmen und zu begreifen, sondern als Zustände seines eigenen „Ich“.
Die Entdeckung Ihrer inneren Welt ist ein freudiges und aufregendes Ereignis. Aber es verursacht auch viele verstörende, dramatische Erlebnisse. Das innere „Ich“ stimmt nicht mit dem „äußeren“ Verhalten überein und verwirklicht das Problem der Selbstkontrolle.
Mit dem Bewusstsein der eigenen Einzigartigkeit, Einzigartigkeit und des Unterschieds zu anderen geht ein Gefühl der Einsamkeit einher. Das jugendliche „Ich“ ist noch vage, vage und wird oft als vage Angst oder ein Gefühl innerer Leere erlebt, das mit etwas gefüllt werden muss. Daher wächst das Bedürfnis nach Kommunikation und gleichzeitig nimmt ihre Selektivität zu, und es entsteht das Bedürfnis nach Privatsphäre.
Das Selbstbild eines Teenagers oder jungen Mannes korreliert immer mit dem Gruppenbild „Wir“, d.h. Das Bild eines typischen Gleichaltrigen des gleichen Geschlechts stimmt jedoch nie vollständig mit diesem „Wir“ überein. Eine Gruppe Zehntklässler aus Leningrad bewertete, wie typisch bestimmte moralische und psychologische Qualitäten für den durchschnittlichen Jungen oder das durchschnittliche Mädchen ihres Alters und dann für sich selbst waren.4 Die Bilder ihres eigenen „Ichs“ erwiesen sich als viel subtiler und, wenn man so will sanfter als die Gruppe „wir“. Junge Männer halten sich für weniger mutig, weniger kontaktfreudig und fröhlich, dafür aber freundlicher und verständnisvoller als ihre Altersgenossen. Mädchen schreiben sich weniger Geselligkeit, dafür aber mehr Aufrichtigkeit, Fairness und Loyalität zu. Bianca Zazzo (1966) entdeckte die gleiche Tendenz bei jungen Franzosen.5
Die für viele Gymnasiasten charakteristische Übertreibung der eigenen Einzigartigkeit verschwindet normalerweise mit zunehmendem Alter, jedoch nicht auf Kosten einer Schwächung individueller Anfang. Im Gegenteil: Je älter und entwickelter ein Mensch ist, desto größer sind die Unterschiede zwischen ihm und seinem „durchschnittlichen“ Altersgenossen. Das Bewusstsein dafür, dass man anders ist als andere, geht historisch und logisch dem Verständnis der tiefen inneren Verbindung mit den Menschen in der Umgebung und der Einheit mit ihnen voraus.
Nicht weniger schwierig ist das Bewusstsein für die eigene Kontinuität, die Stabilität der eigenen Persönlichkeit im Laufe der Zeit.
Für ein Kind ist von allen Zeitdimensionen die Gegenwart, das „Jetzt“, das wichtigste, wenn nicht das einzige Phänomen. Das Kind hat kaum ein Gespür für den Lauf der Zeit. Die Perspektive eines Kindes auf die Vergangenheit ist nicht großartig; alle bedeutenden Erfahrungen des Kindes sind mit seiner begrenzten persönlichen Erfahrung verbunden. Auch die Zukunft erscheint ihm nur in der allgemeinsten Form.
Für einen Teenager ändert sich die Situation. Erstens nimmt mit zunehmendem Alter die subjektive Geschwindigkeit des Zeitablaufs merklich zu (dieser Trend setzt sich auch im höheren Alter fort: Ältere Menschen wählen, wenn sie über die Zeit sprechen, meist Metaphern, die ihre Geschwindigkeit betonen: ein rennender Dieb, ein galoppierender Reiter usw. , junge Männer - statische Bilder: Straße, die bergauf führt, ruhiger Anstieg, hohe Klippe).
Die Entwicklung zeitlicher Repräsentationen steht in engem Zusammenhang mit beiden geistige Entwicklung und mit einer Veränderung der Lebensperspektive des Kindes. Die Zeitwahrnehmung eines Teenagers bleibt immer noch diskret und auf die unmittelbare Vergangenheit und Gegenwart beschränkt, und die Zukunft erscheint ihm als eine fast wörtliche Fortsetzung der Gegenwart. In der Jugend erweitert sich der Zeithorizont sowohl in der Tiefe, indem er die ferne Vergangenheit und Zukunft abdeckt, als auch in der Breite, indem er nicht nur persönliche, sondern auch soziale Perspektiven einbezieht.
Der Zeitperspektivenwechsel steht in engem Zusammenhang mit der Neuorientierung des jugendlichen Bewusstseins von der Fremdkontrolle hin zur Selbstkontrolle und dem wachsenden Bedürfnis, konkrete Ergebnisse zu erzielen.
Die Erweiterung der Zeitperspektive bedeutet auch, persönliche und historische Zeit näher zusammenzubringen. Bei einem Kind sind diese beiden Kategorien nahezu unabhängig voneinander. Die historische Zeit wird von ihm als etwas Unpersönliches, Objektives wahrgenommen; Ein Kind kennt vielleicht die chronologische Abfolge von Ereignissen und die Dauer von Epochen, und dennoch scheinen sie ihm gleich weit entfernt zu sein. Was vor 30-40 Jahren geschah, ist für einen 12-Jährigen fast so „antik“ wie das, was zu Beginn unserer Zeitrechnung geschah. Damit ein Teenager die historische Vergangenheit und seine Verbindung mit ihr wirklich verstehen und fühlen kann, muss sie zu einer Tatsache seiner persönlichen Erfahrung werden.6 Die Zeitperspektive ist äußerst wichtig, um die altersbedingte Dynamik des reflexiven „Ich“ zu verstehen.
Ein gesteigertes Gefühl für die Unumkehrbarkeit der Zeit geht im jugendlichen Bewusstsein oft mit der Abneigung einher, ihren Lauf zu bemerken, mit dem Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben. Das Gefühl, die Zeit anzuhalten, ist nach dem Konzept des amerikanischen Wissenschaftlers E. Erikson wie eine Rückkehr in einen Kindheitszustand, in dem die Zeit noch nicht in der Erfahrung existierte und nicht bewusst wahrgenommen wurde. Ein Teenager kann sich abwechselnd sehr jung oder sogar sehr klein fühlen, und dann, im Gegenteil, extrem alt, nachdem er alles erlebt hat. Erinnern wir uns an Lermontovs Satz: „Stimmt es nicht, dass jemand, der achtzehn Jahre alt ist, wahrscheinlich noch nie Menschen oder die Welt gesehen hat?“7
Laut Erikson ist die Adoleszenz um eine Identitätskrise herum aufgebaut, die aus einer Reihe sozialer und individueller persönlicher Entscheidungen, Identifikationen und Selbstbestimmungen besteht. Gelingt es einem jungen Mann nicht, diese Probleme zu lösen, entwickelt er eine unzureichende Identität, deren Entwicklung im Wesentlichen auf vier Ebenen erfolgen kann: 1) Rückzug aus psychologischer Intimität, Vermeidung enger zwischenmenschlicher Beziehungen;
2) Erosion des Zeitgefühls, Unfähigkeit, Lebenspläne zu schmieden, Angst vor dem Erwachsenwerden und vor Veränderungen; 3) Erosion der produktiven, Kreativität, Unfähigkeit, die eigenen internen Ressourcen zu mobilisieren und sich auf eine Hauptaktivität zu konzentrieren; 4) die Bildung einer „negativen Identität“, die Verweigerung der Selbstbestimmung und die Wahl negativer Vorbilder.
Erickson arbeitete hauptsächlich mit klinischen Daten und versuchte nicht, die beschriebenen Phänomene quantitativ auszudrücken. Der kanadische Psychologe James Marsha füllte diese Lücke im Jahr 1966, indem er vier Phasen der Identitätsentwicklung identifizierte, gemessen am Grad der beruflichen, religiösen und politischen Selbstbestimmung eines jungen Menschen.
1. „Unsichere, unscharfe Identität“ ist dadurch gekennzeichnet, dass die Person noch keine klaren Überzeugungen entwickelt, keinen Beruf gewählt hat und keine Identitätskrise erlebt hat.
2. Eine „vordringliche, vorzeitige Identifizierung“ liegt vor, wenn sich die Person in das entsprechende Beziehungssystem eingemischt hat, dies jedoch nicht aus eigener Kraft aufgrund der erlebten Krise und Prüfung, sondern auf der Grundlage der Meinungen anderer Personen getan hat , dem Beispiel oder der Autorität einer anderen Person folgen.
3. Die Phase des „Moratoriums“ ist dadurch gekennzeichnet, dass sich das Individuum in einer normativen Selbstbestimmungskrise befindet und aus zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten die einzige wählt, die es als seine eigene betrachten kann.
4. „Erreichte, reife Identität“ wird dadurch bestimmt, dass die Krise vorbei ist und der Einzelne von der Suche nach sich selbst zur praktischen Selbstverwirklichung übergegangen ist.
Identitätsstatus sind sozusagen Stadien der Persönlichkeitsentwicklung und zugleich typologische Konzepte. Ein Teenager mit einer unsicheren Identität kann in eine Moratoriumsphase eintreten und dann eine reife Identität erlangen, kann aber auch für immer auf der Ebene einer verschwommenen Identität bleiben oder den Weg der frühen Identifikation einschlagen und die aktive Wahl und Selbstbestimmung aufgeben.
Ein äußerst wichtiger Bestandteil des Selbstbewusstseins ist das Selbstwertgefühl. Dieses Konzept ist mehrdeutig, es impliziert Selbstzufriedenheit, Selbstakzeptanz, Selbstwertgefühl, eine positive Einstellung sich selbst gegenüber und die Konsistenz des gegenwärtigen und idealen „Ich“ und zeigt an, inwieweit ein Individuum hält sich für fähig, bedeutsam, erfolgreich und würdig. Kurz gesagt ist Selbstachtung ein persönliches Werturteil, das sich in der Einstellung einer Person zu sich selbst ausdrückt. Je nachdem, ob es sich um ein ganzheitliches Selbstwertgefühl des Individuums oder um die Ausübung einzelner sozialer Rollen handelt, unterscheidet man zwischen allgemeinem und privatem (z. B. schulischem oder beruflichem) Selbstwertgefühl. Da ein hohes Selbstwertgefühl mit positiven und ein niedriges Selbstwertgefühl mit negativen Emotionen verbunden ist, ist das Motiv des Selbstwertgefühls „das persönliche Bedürfnis, die Erfahrung positiver Einstellungen zu maximieren und die Erfahrung negativer Einstellungen gegenüber sich selbst zu minimieren“.
Ein hohes Selbstwertgefühl ist keineswegs gleichbedeutend mit Überheblichkeit, Arroganz oder mangelnder Selbstkritik. Ein Mensch mit hohem Selbstwertgefühl hält sich für nicht schlechter als andere, glaubt an sich selbst und daran, dass er seine Mängel überwinden kann. Ein geringes Selbstwertgefühl hingegen impliziert ein anhaltendes Minderwertigkeits- und Minderwertigkeitsgefühl, das sich äußerst negativ auf das emotionale Wohlbefinden und das Sozialverhalten des Einzelnen auswirkt. Der amerikanische Psychologe Maurice Rosenberg (1965) untersuchte über 5.000 Oberstufenschüler (im Alter von 15 bis 18 Jahren) und stellte fest, dass für junge Männer mit geringem Selbstwertgefühl eine allgemeine Instabilität des Selbstbildes und der Meinung über sich selbst typisch ist. Sie neigen eher als andere dazu, sich von anderen zu „verschließen“ und ihnen eine Art „falsches Gesicht“ – „repräsentiertes Selbst“ – zu präsentieren. Mit Urteilen wie:
„Ich spiele oft eine Rolle, um Menschen zu beeindrucken“ und „Ich neige dazu, vor Menschen eine ‚Maske‘ aufzusetzen“, stimmten Jungen mit geringem Selbstwertgefühl sechsmal häufiger zu als solche mit hohem Selbstwertgefühl.
Junge Männer mit geringem Selbstwertgefühl sind besonders verletzlich und empfindlich gegenüber allem, was ihr Selbstwertgefühl irgendwie beeinträchtigt. Sie reagieren schmerzhafter als andere auf Kritik, Lachen und Vorwürfe. Sie sind mehr besorgt über die schlechte Meinung anderer über sie. Sie reagieren schmerzhaft, wenn bei ihnen etwas im Job nicht klappt oder wenn sie bei sich selbst einen Mangel entdecken. Daher zeichnen sich viele von ihnen durch Schüchternheit, eine Tendenz zur geistigen Isolation und einen Rückzug aus der Realität in die Welt der Träume aus, und dieser Rückzug ist keineswegs freiwillig. Je geringer das Selbstwertgefühl einer Person ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie unter Einsamkeit leidet.
Retrospektive Beschreibungen des „schwierigen Alters“ durch Jungen und Mädchen unterscheiden sich deutlich. Die Selbstbeschreibungen junger Menschen sind dynamischer, der Schwerpunkt liegt auf der Entstehung neuer Interessen, Aktivitäten usw. Die Selbstbeschreibungen von Mädchen sind subjektiver und sprechen hauptsächlich von den Gefühlen, die sie empfinden, oft negativ.
Das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl von Jungen und Mädchen hängen stark von stereotypen Vorstellungen darüber ab, was Männer und Frauen sein sollten, und diese Stereotypen wiederum sind auf die Differenzierung der Geschlechterrollen zurückzuführen, die sich historisch in einer bestimmten Gesellschaft entwickelt hat.
Noch schwieriger ist es, umfassende Verallgemeinerungen über das Aktivitätsniveau, die Wettbewerbsfähigkeit, die Dominanz und den Gehorsam von Jungen und Mädchen zu treffen. Viele Psychologen halten die ersten drei Eigenschaften für charakteristischer für Jungen und die vierte für Mädchen. Allerdings hängt viel vom Alter, dem Tätigkeitsinhalt und dem Erziehungsstil ab. Jungen jeden Alters neigen dazu, sich stärker, energischer, kraftvoller und zielorientierter zu betrachten als Mädchen. Gleichzeitig überschätzen Teenager oft ihre Schwächen und hören nicht genug auf Informationen, die ihrem überhöhten Selbstwertgefühl widersprechen. Mädchen sind selbstkritischer und sensibler.
Aus dem oben Gesagten folgt, dass es notwendig ist, Bildung und Ausbildung zu individualisieren und mit gewohnheitsmäßigen Stereotypen und Standards, die auf durchschnittliche, statistisch durchschnittliche Personen abzielen, aufzubrechen.
Die wichtigste psychologische Errungenschaft im Jugendalter ist die Entdeckung der eigenen inneren Welt. Die Bildung einer neuen Zeitperspektive ist mit bekannten psychischen Schwierigkeiten verbunden. Ein gesteigertes Gefühl für die Unumkehrbarkeit der Zeit geht im jugendlichen Bewusstsein oft mit der Abneigung einher, ihren Lauf zu bemerken, mit dem Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben. Ein solches „Anhalten“ der Zeit bedeutet psychologisch gesehen eine Rückkehr in einen Kindheitszustand, in dem die Zeit noch nicht im Erleben existierte und nicht bewusst wahrgenommen wurde.
Die Hauptschwierigkeit der jugendlichen Reflexion ist die richtige Kombination dessen, was A.S. Makarenko als kurz- und langfristig bezeichnete. Kurzfristig sind die unmittelbaren Aktivitäten von heute und morgen und ihre Ziele. Langfristige Perspektive – langfristige Lebenspläne, persönlich und sozial.
Aus psychologischer Sicht ist das Aufkommen einer Frage nach dem Sinn des Lebens ein Symptom einer gewissen Unzufriedenheit. Wenn ein Mensch völlig in etwas versunken ist, fragt er sich meist nicht, ob die Sache Sinn macht. Reflexion, eine kritische Neubewertung von Werten psychologisch ist in der Regel mit einer Art Pause, einem „Vakuum“ in der Aktivität oder in den Beziehungen zu anderen Menschen verbunden. Und gerade weil diese Frage grundsätzlich praktischer Natur ist, kann nur die Aktivität eine befriedigende Antwort darauf geben.
Jeden Tag und jede Stunde steht ein Mensch, ohne es zu merken, vor einer Entscheidung, die sein Leben bestätigen oder sogar streichen kann. „Die Entdeckung des Selbst“ ist kein einmaliger und lebenslanger Erwerb, sondern eine ganze Reihe aufeinanderfolgender Entdeckungen, von denen jede ohne die vorherigen unmöglich ist und gleichzeitig Anpassungen an ihnen vornimmt.
Das Maß an Freiheit ist auch das Maß an Verantwortung, und die von einem begonnene Arbeit wird von anderen fortgesetzt.
Anmerkungen
1 Korczak. Wie man Kinder liebt. Minsk, 1980. S. 6.
2 Lichko A.E. Jugendpsychiatrie. L., 1979. S. 17-18.
3 Isaev D.N., Kagan V.E. Sexualerziehung und mentale Hygiene beim Sex bei Kindern. L., 1979. S. 154.
4 Siehe: Kon I.O., Losenkov V.A. Jugendfreundschaft als Gegenstand empirischer Forschung // Kommunikations- und Bildungsprobleme. Bd. 2/ Rep. Hrsg. M. H. Titma. Tartu, 1974.
5 ZazzoB. Differenzielle Psychologie der Jugend. Paris, 1966. S. 63-123.
6 Zu den Formen des „Einwachsens“ der historischen Vergangenheit in persönliche Erfahrung Kind, siehe Kurganov S.Yu. Kind und Erwachsener im Bildungsdialog. M., 1989.
7 Lermontov M.Yu. Sashka // Lermontov M.Yu. Sammlung Op. In 4 Bänden. T. 2. M., 1958. S. 388.
8 Rosenberg M. Gesellschaft und das jugendliche Selbstbild. Princeton, 1965.
Thema: „Meine sozialen Rollen“
Ziel: eine Vorstellung von verschiedenen sozialen Rollen geben, eine Vorstellung von der Rolle als Führer der Gesellschaft geben (wünschenswerte, akzeptable, abgelehnte (inakzeptable) Rollen).
Aufgaben:
das Spektrum der Persönlichkeitsrollen aufzeigen;
Kindern die Möglichkeit geben, neue Verhaltensweisen in realitätsnahen Situationen anzuwenden;
Modellieren Sie erfolgreichere Verhaltensweisen und spielen Sie sie in einer sicheren Umgebung im Rollenspiel.
Geben Sie Kindern die Möglichkeit, ungewohnte Gefühle zu erleben, neue Gedanken und Ideen wahrzunehmen;
Feedback geben.
Grenzbildung in schwierigen zwischenmenschlichen Situationen;
Bewusstsein für die Motive individuellen Verhaltens; Entwicklung von Empathiefähigkeiten.
Fortschritt der Lektion
1. Einführungsteil
Führend.Es gibt die Meinung, dass eine Person aus einer Reihe von Rollen besteht. Zu jedem Zeitpunkt können wir uns nicht nur als ein komplexes Rollengefüge betrachten, sondern im Laufe der Zeit werden die Rollen, die wir spielen müssen, erweitert, vertieft, treten vorübergehend in den Hintergrund oder verschwinden sogar allmählich aus dem Repertoire. Einige von ihnen kommunizieren ständig miteinander, andere führen einen einsamen Lebensstil.
Kurz gesagt, jeder von uns kann als Gruppe betrachtet werden. Der Moment der Diskrepanz zwischen der Rolle und dem inneren „Ich“ lässt uns über Masken sprechen. Diese Masken können viele aushalten verschiedene Formen. Zum Beispiel setzt sich jeder von euch, der an seinem Schreibtisch sitzt, eine Maske auf guter Schüler. Wenn du die Schule verlässt, umgeben von Freunden, wechselst du deine Maske. Loma bekommt einen neuen Look.
Masken werden geschaffen, um Menschen bei der Bewältigung des Lebens zu helfen, und können daher als „Bewältigungsmasken“ betrachtet werden. Jeder von ihnen hat seine eigene Natur. Sie werden für eine bestimmte Lücke erstellt. Sie alle haben etwas über sich selbst zu sagen und jede Geschichte wird mit Gefühlen verbunden sein, die zu stark sind, um sie einzudämmen. Deshalb braucht ein Mensch eine Maske, um sie zu verbergen, zu fesseln und von sich selbst zu trennen.
Somit schützt die Maske einerseits die Person, andererseits auch- ist ein Fenster in seine komplexe Innenwelt.
2. Hauptteil
Gruppendiskussion
Besprechen Sie die Bandbreite der Rollen, die einer Person, insbesondere einem Teenager, innewohnen. Die Meinungen der Kinder werden auf einem großen Blatt Papier niedergeschrieben. Ein Teenager kann beispielsweise die folgenden Rollen einnehmen: Schüler, Sohn, Bruder, Kunde, Freund usw.
Erfahren Sie, wann, warum und in welchen Situationen Menschen Masken tragen. Unfähig, unsere wahren Gefühle auszudrücken, verstecken wir uns hinter Masken, zum Beispiel „Egal“, „Braves Mädchen“, „Partylöwe“, „ cooler Typ", "Jammerer und Langeweile" usw.
Spiel „Masken, die wir tragen“
Teilen Sie die Kinder in Paare auf. Jedes Paar sollte zwei Stühle haben. Bieten Sie an, eine kleine Szene aus dem Leben nachzuspielen, zum Beispiel: Käufer – Verkäufer, Schüler – Lehrer, Eltern – Kind usw., in der ein Teilnehmer eine Maske „aufsetzt“. Dann wechseln die Kinder die Plätze und der zweite Teilnehmer wird zur Maske des ersten, das heißt, die Maske wird hervorgeholt (benannt). Als nächstes entwickeln die Partner einen Dialog zwischen der Maske und „Ich“. Danach wird die Maske des zweiten Teenagers gespielt.
Wenn es den Kindern zu Beginn des Spiels schwerfällt, die Aufgabe zu bewältigen, sollte der Leiter die Übung am Beispiel eines der Paare nachspielen.
Diskussion
Führend.IN Alltagsleben Eine Person muss beispielsweise mit Problemen konfrontiert werden, wenn sie eine Straftat begeht. In diesen Fällen fällt es uns schwer, die Situation angemessen und unvoreingenommen wahrzunehmen, die Schuld auf uns zu nehmen und unsere Erfahrungen zu erkennen sowie den Standpunkt eines anderen zu akzeptieren. Es fällt Ihnen oft schwer, sich vorzustellen, was eine andere Person fühlen oder denken könnte.
Der Rollenwechsel hilft, sich in die Lage eines anderen zu versetzen Konfliktsituationen - zwischen einem Kind und Eltern, zwischen einem Kind und einem Lehrer, zwischen einem Kind und Gleichaltrigen. Der Zweck des Rollentauschs besteht darin, den Standpunkt eines anderen zu verstehen und dadurch sein Verhalten oder seine Einstellung zu ändern.
Rollentauschspiel
Teilen Sie die Gruppenmitglieder in Paare auf. Legen Sie Themen für Konfliktsituationen fest, zum Beispiel: Treffen mit einem Verkehrsleiter bei Reisen ohne Fahrschein; kam am nächsten Morgen von der Disco nach Hause; nahm Geld von Eltern usw. ohne Erlaubnis (unter Berücksichtigung der geäußerten Meinungen). Spielen Sie eine Situation durch, in der Sie versuchen, den Standpunkt eines anderen zu akzeptieren, Verantwortung für die begangene Tat zu übernehmen und sich nicht demütigen zu lassen, wenn Sie die Schuld auf sich nehmen.
Diskussion der Positionen der Konfliktparteien
Besprechen Sie, wie die gewonnenen Erkenntnisse auf ähnliche Situationen im wirklichen Leben angewendet werden können.
3. Letzter Teil
Schlussfolgerungen
In Konfliktsituationen kann es schwierig sein, sein Verhalten und seine Emotionen zu kontrollieren, was sich negativ auf die Klärung von Beziehungen auswirkt. Wenn Sie es geschafft haben, Verantwortung zu übernehmen, müssen Sie auch in der Lage sein, Ihre Rechte zu verteidigen, ohne Ihr Selbstwertgefühl zu verlieren.
Der Rollentausch hilft, den Standpunkt des anderen zu verstehen.
Lektion 7
Thema: Meine sozialen Rollen
Ziele : Kinder an soziale Rollen heranführen,fördern eine erfolgreiche Interaktionin verschiedenen sozialen Situationen undAufbau konstruktiver Beziehungen in der Gesellschaft.
Ausrüstung : Karten „Ich bin wie alle anderen ...“, „Ich bin nicht wie alle anderen ...“, mit Auflistung der sozialen Positionen „Sohn“, „Tochter“, „Student“, „Junge“, „Mädchen“, Blätter mit einem Bild des Himmels (Sonne und zwei Wolken), Filzstifte, Buntstifte, zwei Kugeln in verschiedenen Farben, lebend oder künstliche Blume, Abspielgerät.
Fortschritt der Lektion:
1. Einführungsteil. Aktualisierung des Wissens über die eigene Individualität.
Nach der Begrüßung reichen die Kinder die Blume im Kreis herum und sagen ihren Namen. Gleichzeitig benennen sie ihre inhärenten Eigenschaften, die mit den Buchstaben im Namen beginnen (zum Beispiel Olga – vorsichtig, faul, stolz; Vadim – höflich, freundlich, interessiert). Die aufgeführten Eigenschaften werden auf die Tafel (Blatt) geschrieben. Am Ende der Übung ermutigt der Moderator die Teilnehmer anhand der gemachten Notizen, Schlussfolgerungen zu ziehen, dass sich Menschen in ihrem Äußeren und ihrem Äußeren unterscheiden interne Eigenschaften und Qualitäten, die sich in der Einzigartigkeit der menschlichen Psyche und Persönlichkeit manifestieren.
1.Hauptteil . Gespräch über menschliche Interaktion mit der Außenwelt.
Moderator: sagt, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, er lebt unter Menschen, zu denen er seine Beziehungen aufbaut. Essen„Ich“, meine engste Umgebung ist um mich herum. Das ist meine Familie, enge Freunde, also eine Mikrogesellschaft. Der nächste Interaktionsbereich sind Verwandte, Freunde, Bekannte, Nachbarn, Kollegen, Klassenkameraden, Lehrer, jene Menschen, mit denen die Interaktion für mich von großer Bedeutung ist. Die nächste Ebene sind die Menschen, die keinen großen Einfluss auf mein Schicksal haben.wir kennen sie normalerweise nicht persönlich. Dies ist ein Verkäufer in einem Geschäft, ein Schaffner in TranceHafen, ein Arzt, Schüler... Die am weitesten entfernte Ebene sind diejenigen, dieÜber deren Existenz wir selten nachdenken, zum Beispiel einen einsamen alten FischPanzer von der Küste Australiens... Sie können sich dies in Form eines visuellen Diagramms vorstellen, das aus 4 konzentrischen Kreisen besteht, in der Mitte – „I“ und rundherum – mit zielgerichtete Bereiche.
Zeichnung „Ich und meine Welt um mich herum“
Ziel ist es, das Kind darzustellen und zu verstehenWichtige Bereiche Ihrer Umgebung, Klärung IhrerBeziehungen zur Außenwelt.
Nehmen Sie ein Blatt Papier... Zeichnen Sie und lassen Sie die Mitte des Blattes leer. Zeichnen Sie alles ein, was Sie im Leben umgibt, mit wem und womit Sie interagieren müssen – Ihre soziale Welt.Hast du es gezeichnet? Zeichnen Sie sich jetzt in die Mitte.“
Diskussion
Erzähl mir etwas über deine Zeichnung. Gefällt es dirGefällt dir deine Zeichnung, gefällt dir dein Porträt? Wasdavon, was gezeichnet wird, ist für Sie am wichtigsten und was -am wenigsten? Gibt es eine Trennlinie zwischenSchlacht und die umliegende Welt? Warum bist du hier?gegenüber auf dem Bild? Wie interagieren Sie mit demWas zieht dich um? Was bedeutet das für Sie?
Mögliche Modifikation der Übung. Markieren Sie das Schild auf Ihrer Zeichnungcom „plus“ positive Verbindungen (mit wem und womit interagieren Sie gerne).Mehrwertsteuer) und ein „Minus“-Zeichen – negative Verbindungen (mit wem oder womit es unangenehm istinteragieren).
Ein Mensch lebt nicht allein, sondern zusammen mit anderen Menschen seine Familie überlebte. Es ist schwierig für einen Menschen, alleine zu leben, sogar Robinson hat es genutztmit anderen Leuten - einer Waffe, einem Messer, und war froh, Freitag kennenzulernen.
Es ist notwendig, die Grenzen des eigenen „Ichs“ in der Gesellschaft zu bestimmen,wie kann ich anrufendein? Erstens ist dies der Name, das Geschlecht, das Aussehen. Es ist nicht sehrhängt von uns ab: Das Aussehen ist uns von Natur aus gegeben, der Name wurde von unseren Eltern gegeben, wir gehen zu ihnenseit meiner Kindheit daran gewöhnt. Wenn wir erwachsen werden, fangen wir an, sie zu erkennen, wir können es bereitsWir entwickeln unsere eigene Einstellung ihnen gegenüber, und das gibt uns die Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob wir wollenob wir etwas an ihnen ändern oder nicht. Wie wir wollen, dass andere uns sehen Wow?
Rollen und soziale Institution- die Gesellschaft, die mein Leben umgibt wandern. M wir spielen sicherRollen, Anpassung an die Gesellschaft. Wir entscheiden, welches Gesicht wir der Welt zeigenwie wir gesehen werden möchten. Jeder von uns nimmt es auf sichviele Rollen. Die Rolle ist ein Leitfaden für die Gesellschaft, der ein natürlicheres Leben ermöglichtDas Eindringen in die Umgebung sorgt effektiv für erfolgreiche Aktivität und Interaktion.Die Gesellschaft knüpft bestimmte Erwartungen an die Rolle. Ein Mensch hat Vorstellungen davon, was die Gesellschaft in dieser Rolle von ihm erwartet und was er von der Gesellschaft erwartetund von anderen. Wenn die Erwartungen an die Rolle der Interaktionsteilnehmer nicht übereinstimmenDies führt jedoch zu Konflikten. Soziale Erwartungen zu verstehen und Rollen zu meistern steigert den sozialen Erfolg. Die Rollen, die wir wählenWas wir essen, hängt von unseren Lebenszielen ab.
Die Rolle ist erkennbar, wenn wir über die Rolle sprechen, sprechen wir über das Erkennbare, überetwas gemeinsam. Eine Rolle setzt die Verwirklichung bestimmter Eigenschaften einer Person voraus.Ehrungen Gleichzeitig bringen wir etwas Persönliches in seine Leistung ein, wir bleibenselbst. Sie können sich eine Rolle in Form eines Rahmens, eines Standardrahmens, vorstellenin die wir uns einfügen müssen, und gleichzeitig füllen wir es mit etwas Eigenem.Sprechen wir über die Tatsache, dass die Rolle bestimmte Grenzen und Rahmenbedingungen voraussetztDass „passen“ muss, kann zur Veranschaulichung herangezogen werdensichtbares Material wie Papier in verschiedenen Formen und Größen – Ellipse, schmalPapierstreifen, Stern, spiele mit dieser Form: Wie fülle ich diesen Raum?Qualität? Wie mache ich das? Inwieweit berücksichtige ich die Form, in der die Aktion jetzt vorliegt?bin ich? Mit welcher Rolle verbinde ich dieses Formular? Wie wohl fühle ich michSehe ich mich in dieser Rolle?
Übung „Rollenpaare“
Die Teilnehmer stehen im Kreis.
„Sie und ich haben über die Rollenpaarung gesprochen. Jetzt lasst uns dieses Spiel spielen: einander einen Ball zuwerfen,Wir werden eine Rolle benennen. Derjenige, der den Ball erhältnennt zuerst ihre Rolle und dann einige
seine Rolle und wirft den Ball einer anderen Person zu usw.“Nach dieser Übung können Sie spielenSzenen ohne Worte schreiben. Zwei Teilnehmer (Freiwillige)Verlassen Sie den Raum und denken Sie über ein Paar nachRollen, zum Beispiel Clown-Zuschauer, Verkäufer-Käufer,usw. Dann kommen sie zurück und zeigen eine Szene ohne Worte. Der Rest der Teilnehmer muss ratenwelche Rollen waren geplant.
Konnten Sie erraten, welche Rollen dargestellt wurden? Washat geholfen (verhindert), es herauszufinden
ist es? Anschließend spielen andere Teilnehmer die Sketche vor.
Modifikation der Übung. Die Teilnehmer werden in zwei Untergruppen eingeteilt -Rollenfüller und Beobachter. Es muss eine gerade Anzahl an Darstellern vorhanden seindein. Sie gehen aus der Tür und entscheiden über Rollen, und Rollen müssen“gepaart werden. Einer nach dem anderen betreten sie den Raum und sagen etwasder erste Satz der Rolle. Beobachter müssen erraten, was diese Rolle ist, und nachdem alle Spieler ihre Rollen gespielt haben, versuchen sie, die Paare zu verbinden (Verkäufer mit Käufer, Arzt mit Patient usw.). Sobald die Verbindung hergestellt ist, kann jedes PaarSpielen Sie die ganze Szene.
Moderator: Jeder Mensch spielt je nach Situation unterschiedliche soziale Rollen. Wissen Sie, welche sozialen Rollen jeder von Ihnen zu Hause, in der Schule und unter Gleichaltrigen spielt? (Antworten der Kinder).
Anschließend sprechen die Kinder über Verhaltensmerkmale in Abhängigkeit von ihrer sozialen Rolle:
Ich bin der Sohn
Ich bin die Tochter
Ich bin ein Schüler
Ich bin ein Junge
Ich bin ein mädchen
Ich gehöre zu meinen Kollegen.
Moderator: Haben Sie jemals über Ihre Position in Ihrer Peergroup nachgedacht? Fühlst du dich unter ihnen wohl?
Hat die Gruppe einen positiven oder negativen Einfluss auf Ihr Verhalten?
Wie beeinflussen Sie den Personenkreis (Gleichberechtigte und Erwachsene), in dem Sie sich ständig bewegen? (Antworten der Kinder).
Übung „Ich bin einzigartig.“
Der Anführer passt zwei Bälle zu verschiedene Seiten Drücken. Der Teilnehmer, der den ersten Ball erhalten hat, setzt die Aussage „Ich bin wie alle anderen ...“ fort, während er eine der auf den Karten angegebenen sozialen Positionen („Sohn“, „Schüler“ usw.) wählt Der zweite Ball führt ähnliche Aktionen aus und setzt die Aussagen „Ich bin nicht wie alle anderen ...“ fort. Irgendwann treffen die Bälle in den Händen eines Teilnehmers aufeinander. Er wird gebeten, den Satz auszuwählen, mit dem er zu sprechen beginnen möchte.
Zusammenfassend kommt der Moderator zu dem Schluss, dass wir alle welche haben allgemeine Qualitäten, und es gibt auch einzigartige, nur einem Individuum innewohnende.
Übung „Selbstporträt“
Jeder Teilnehmer ist eingeladen, auf einer der Wolken seinen Vor- und Nachnamen und auf der anderen den Namen zu schreiben, mit dem er angerufen werden möchte, und zwar in einer Zeichnung, die Wolken und die Sonne darstellt. In der Mitte der Sonne wird vorgeschlagen, ein symbolisches Selbstporträt darzustellen und auf 2-3 Sonnenstrahlen die Eigenschaften des Teilnehmers aufzuschreiben, die ihm helfen, schwierige Lebenssituationen zu meistern.
Die Aufgabe wird zu Musik ausgeführt.
Beenden der Lektion
Übung „Live-Fragebogen“
Alle Teilnehmer im Kreis antworten nächste Fragen:
· Gab es während dieser Lektion etwas Unerwartetes für Sie?
· Was hat dir gefallen?
· Was hat Ihnen nicht gefallen?