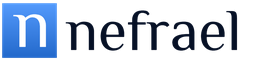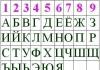Konfliktpräventionskurse sollten regelmäßig stattfinden, möglichst ein- bis zweimal pro Woche. „Fragen, die wir verstehen müssen, bevor wir mit der Konfliktprävention beginnen“ helfen uns dabei, die Hauptrichtungen der Arbeit zu bestimmen und zu entscheiden, welche Themen oder Abschnitte für eine bestimmte Klasse von primärer und welche von untergeordneter Bedeutung sind. Es ist nicht notwendig, die geplanten Aktivitäten in einer strengen Reihenfolge durchzuführen; Sie müssen flexibel sein. Dazu empfiehlt es sich, mehr Zeit einzuplanen, um auf allerlei Überraschungen vorbereitet zu sein.
Vor diesem Hintergrund haben wir ein Programm entwickelt, um Schülern konfliktfreies Verhalten beizubringen.
Dieses Programm hat das Ziel, Grundschüler für die Lösung von Konfliktsituationen zu entwickeln und zu formen.
Das Programm hat folgende Ziele: Kindern zu helfen, aus Konfliktsituationen herauszukommen; ihren Sinn für Zusammenarbeit entwickeln; Respekt für andere lehren.
Das Programm ist auf 30 Übungen ausgelegt, die täglich während einer großen Pause durchgeführt werden sollten.
Der Raum für die Durchführung von Unterrichtsstunden sollte sowohl Hörarbeit (also Arbeit am Schreibtisch) als auch Arbeit „im Kreis“ sowie motorische Übungen und die Möglichkeit zum Arbeiten in bequemen Positionen ermöglichen.
Dieses Programm umfasst drei Phasen:
1. Indikativ (10 Spiele und Übungen)
2. Rekonstruktiv (14 Spiele und Übungen)
3. Stärkung (6 Spiele und Übungen)
Im Spiel- und Übungssaal werden folgende Schwerpunkte für die Vermittlung konfliktfreien Verhaltens erarbeitet:
Entwicklung eines Selbstwertgefühls;
Entwicklung der Zusammenarbeit;
Gewaltfreie Konfliktlösung;
Im Unterricht ist bei der Auswahl der Spiele und Übungen Vorsicht geboten. Wenn Spiele und Übungen eine unerwünschte Wendung nehmen oder beispielsweise aus dem einen oder anderen Grund nicht zum gewünschten Ergebnis führen können, sollten Sie sofort damit aufhören. Dies kann bei Übungen passieren, wenn ein gruppendynamischer Prozess beginnt, bei dem einzelne Kinder beleidigt, isoliert und aggressiv angegriffen werden können.
Bei der Arbeit ist es wichtig, eine Reihenfolge einzuhalten, in der Übungen und Spiele zum Kennenlernen der Teilnehmer und zur Selbstoffenbarung in den ersten Unterrichtsstunden (also im 1. Arbeitsschritt) und Übungen zum Kennenlernen der Teilnehmer konzentriert werden Bildung und Entwicklung der Zusammenarbeit sowie gewaltfreie Konfliktlösung liegen eher in der Mitte des Zyklus (Stufe 2 des Programms).
Schauen wir uns die erfolgreichsten Fragmente unserer Arbeit an.
In der 1. Stufe – indikativ – wurden folgende Aufgaben gestellt:
1) Reduzierung emotionalen Stresses;
2) Schaffung einer „+“-Stimmung und einer Atmosphäre der Akzeptanz für alle;
3) Lernen Sie, Ihre Gefühle zu kontrollieren und Konflikte zu beseitigen.
Diese Probleme haben wir mit Hilfe von Spielen und Übungen gelöst.
Fragment 1.
Thema: „Bekanntschaft“.
Ziel: Respekt und Toleranz füreinander entwickeln.
Spiel: „Unterwegs Namen auswendig lernen.“
Anleitung: Alle stehen im Kreis, sagen ihren Namen und machen eine Bewegung. Dann dreht sich alles im Kreis: Der neben ihm stehende Schüler stellt sich zunächst den ersten vor, wiederholt seine Bewegung, dann macht er selbst eine Bewegung.
Anschließend wird die Übung analysiert – die Kinder beantworten eine Reihe von Fragen:
Welche Gefühle hattest du?
War die Aufgabe schwierig oder einfach?
War es schwierig, sich an die Bewegungen zu erinnern?
So lernen die Kinder beim Spielen dieses Spiels, einander zu respektieren und jeden Schüler aufmerksam zu beobachten, um sich die Bewegungen zu merken.
Und auch die Spiele „Wenn ich ein Tier wäre...“, „Spinnennetz“, „Namensschilder“, „Drei Kleiderwechsel“, „Obstsalat“, „Ballon“, „Farben“, „Gewitter“ sind angesprochen Respekt voreinander, Beherrschung der eigenen Gefühle.
In Stufe 2 wurden folgende Aufgaben gelöst:
1) Gefühle des Selbstwertgefühls und des Respekts gegenüber anderen entwickeln;
2) In der Lage sein, zuzuhören und sich auszudrücken;
3) Fördern Sie die Zusammenarbeit im Klassenzimmer.
Zu diesem Zeitpunkt wurden 14 Spiele und Übungen zu folgenden Themen durchgeführt:
1. „Ein Gefühl der Selbstachtung und des Respekts für andere entwickeln.“
2. „Die Fähigkeit, zuzuhören und sich auszudrücken.“
3. „Wahrnehmung von Gefühlen.“
4. „Zusammenarbeit“.
Fragment 2.
Thema: „Die Fähigkeit, zuzuhören und sich auszudrücken“
Spiel: Gut zuhören und schlecht zuhören“
Ziel: die Fähigkeit entwickeln, anderen zuzuhören.
Vorbereitung: Bereiten Sie ein kurzes Rollenspiel vor. Die Klasse schaut zu. Einer der Spieler beginnt die Geschichte zu erzählen, der zweite hört zu Beginn sehr schlecht zu. Unterbrechen Sie nach ein paar Minuten und beginnen Sie mit dem Unterschied, dass der Zuhörer jetzt ganz aufmerksam ist: Sein Blick ist auf den Erzähler gerichtet, sein Gesicht drückt Teilnahme aus; Von Zeit zu Zeit stellt er klärende Fragen. Dann stellt der Lehrer Fragen: „An welchen Anzeichen merken Sie, dass Ihnen nicht gut (oder aufmerksam) zugehört wird?“
Zusammenfassend:
Wie haben Sie sich in beiden Rollen gefühlt?
Was sind das für Gefühle?
Ist das wichtig oder nicht? Warum?
Stufe 2 beinhaltete Spiele und Übungen wie „Rate mal“: „Wer bin ich?“, „Guter Zwerg“ und viele andere, die sehr effektiv sind und Ergebnisse zeigen.
In Stufe 3 wurden folgende Aufgaben gelöst:
1) in der Lage sein, Situationen außerhalb und innerhalb der Schule zu analysieren;
2) Lernen Sie, Ihr eigenes Verhalten in Konfliktsituationen zu verstehen und zu bewerten;
3) Methoden zur gewaltfreien Konfliktlösung entwickeln.
Zu diesem Zeitpunkt wurden 6 Spiele und Übungen zu folgenden Themen durchgeführt:
1. „Ansätze zu Konflikten.“
2. „Gewaltfreie Konfliktlösung.“
Fragment 3.
Thema: „Gewaltfreie Konfliktlösung.“
Übung: „Konflikte im Klassenzimmer.“
Der Kern der Übung: Lösungen für typische Konflikte finden.
Vorbereitung: Die Klasse wird in Kleingruppen aufgeteilt. Der Lehrer beschreibt Konfliktsituation, diskutieren kleine Gruppen gleichzeitig darüber. Um den Kern des Konflikts zu formulieren, sind 3 Minuten vorgesehen.
Antworten auf die Frage, Diskussion. Anschließend laden wir die Gruppen ein, die optimale Lösung zu finden. (3 Minuten)
Fragen Sie die Schüler, welche Lösung sie gefunden haben.
Fragment 4.
Außerdem fand eine Unterrichtsstunde zum Thema „Konflikte in unserem Leben“ statt.
Zweck: 1) die Regeln zur Konfliktverhütung einzuführen;
2) Entwicklung von Fähigkeiten des moralischen Selbstbewusstseins;
3) Lösung des Problems der Erhöhung des Klassenzusammenhalts.
Ausrüstung: Plakat, Emblem, farbige Quadrate zur Reflexion, Seil.
Fragment:
Lehrer: Jungs, bitte teilen Sie sich in zwei Gruppen auf: eine aus Jungen, die andere aus Mädchen. Jetzt werden wir ein einfaches Tauziehenspiel spielen. (Sie spielen).
Die Jungenmannschaft gewann. Danke. Hinsetzen. Glauben Sie, dass es aufgrund dieses Spiels zu einem Konflikt kommen könnte?
Studenten: Ja. Jungen sind stärker. Der Richter urteilte. Zuschauer mischten sich ein. Einige zogen mit voller Hingabe, andere hielten nur zur Schau durch.
Lehrer: Ja, diese Situation ähnelt einem Konflikt. Was braucht es, damit ein Konflikt entsteht?
Studierende: Damit ein Konflikt entsteht, müssen mindestens zwei Personen anwesend sein und der Streitgegenstand anwesend sein.
Lehrer: Jetzt spielen wir eine andere Situation durch. (In der Mitte der Gruppe wird eine Übung durchgeführt: Zwei Freiwillige demonstrieren eine „Ja-Nein“-Übung am Beispiel einer Situation im Klassendienst.)
Studierende: Ja, es gibt einen Konflikt, weil es zwei Personen sind und der Streitgegenstand die Pflicht ist.
Am Ende dieser Unterrichtsstunde stellten wir folgende Frage:
Finden Sie die Auseinandersetzung mit diesem Thema hilfreich und wird es Ihr Verhalten in Konfliktsituationen verändern?
Dabei haben wir erfahren, dass 72 % der Studierenden die Auseinandersetzung mit dem Thema „Konflikte in unserem Leben“ als sinnvoll erachten und ihr Verhalten in Konfliktsituationen zum Besseren verändern werden.
16 % der Studierenden beantworteten diese Frage mit „Nein“ und glauben, dass sich ihr Verhalten in Konfliktsituationen nicht ändern wird, sondern gleich bleibt. 12 % der Studierenden zögerten mit der Antwort, weil sie glauben, dass sich ihr Verhalten in Konfliktsituationen manchmal zum Besseren ändern kann.
So kamen wir zu dem Schluss, dass unsere Arbeit nicht umsonst war, dass die Kinder verstanden haben, dass jeder Konflikte vermeiden kann und dass dies in jeder Situation möglich ist. Im zweiten Kapitel führten wir experimentelle und praktische Arbeiten zur Entwicklung von Methoden des konfliktfreien Verhaltens der Schüler durch, d. h. analysierte Situationen im Klassenzimmer und bei jüngeren Schulkindern und entwickelte ein Programm, um den Schülern konfliktfreies Verhalten beizubringen.
Auf dieser Grundlage sind wir für Lehrer da Grundschulklassen Wir geben einige methodische Empfehlungen:
Der Unterricht basiert auf Materialien, die für Kinder nah und verständlich sind und sich auf aktuelle Situationen beziehen. Dies ermöglicht es ihnen, ihr Verhalten mit dem Verhalten ihrer Mitmenschen zu vergleichen, sich auszudrücken und zu verstehen;
Ein kreativer Ansatz zur Lösung von Konfliktsituationen im Klassenzimmer trägt zur Entwicklung der Suchaktivität der Schüler bei;
Während der gesamten Spiel- und Übungsdauer muss derselbe Raum vorhanden sein;
Der Raum sollte relativ geräumig sein;
In der Anfangsphase ist es besser, mehr Übungen zu geben, die paarweise durchgeführt werden; Dadurch können Sie die gesamte Gruppe schnell in die aktive Arbeit einbeziehen;
Bei Übungen zu zweit empfiehlt es sich, häufig den Partner zu wechseln und so den Respekt anderer zu gewinnen;
Das Material ist vorab vorbereitet und liegt zur Hand;
Es wurde festgestellt, dass eine Person, die in Konflikten über bestimmte Verhaltensstile verfügt, einen größeren Vorteil hat, da sie sich an die Situation anpassen und den optimalen Weg zur Lösung finden kann.
In Kinderkämpfen (im höheren Vorschulalter) sammelt das Kind erste Konfrontationserfahrungen und setzt erstmals verschiedene Verhaltenstaktiken im Konflikt um. Die Auswahl und Bevorzugung einer dieser Möglichkeiten wird durch das Beispiel und die Anweisungen von Erwachsenen erheblich erleichtert.
Beispiele hierfür sind die folgenden Formulierungen:
„Warum beschwerst und nörgelst du? Kannst du nicht für dich selbst einstehen?“
„Man kann sich immer einvernehmlich einigen und sich nicht gegenseitig unter Druck setzen. Sie müssen höflich sagen oder fragen. Erinnern Sie sich an das Zauberwort? »
„Damit ich so etwas nicht noch einmal sehe. Finden Sie es selbst heraus, es hat keinen Sinn, dass ich herumgehe und mich beschwere, sonst schlage ich sowohl die Richtigen als auch die Falschen in die Schranken und schiebe sie in verschiedene Ecken.“
Bei solchen Aussagen kommt es zu einer Art Programmierung von Kindern durch Erwachsene. Durch die Wahrnehmung der Einschätzungen Erwachsener entwickeln Kinder eine Vorstellung von den Normen sozialer Interaktion. Daher ist es für Eltern und Erzieher wichtig, bei ihren Aussagen besonders aufmerksam und vorsichtig zu sein. Erwachsene müssen in der Lage sein, die möglichen Folgen vorschneller Urteile gegenüber Kindern vorherzusehen und ihnen von Kindheit an den Wunsch nach Partnerschaft, Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe zu vermitteln.
Bei der Lösung von Konflikten zwischen Kindern muss der Lehrer darauf achten, wie sich Kinder in Konfliktsituationen verhalten. Dabei empfiehlt es sich, auf das psychologische Modell des Psychologen K. Thomas zurückzugreifen, das es ermöglicht, den bevorzugten Verhaltensstil des Kindes zu bestimmen im Konflikt oder das von einer Gruppe amerikanischer Psychologen vorgeschlagene Modell1 .
Im Rahmen des vorgeschlagenen Modells von K. Thomas wird Konfliktverhalten in einem Raum aufgebaut, der durch ein wie folgt interpretiertes Koordinatensystem definiert ist:
Die vertikale Achse gibt den Grad der Beharrlichkeit bei der Befriedigung der eigenen Interessen an, dargestellt als Bedeutung der Ergebnisse;
Auf der horizontalen Achse ist der Grad der Compliance bei der Befriedigung der Interessen anderer Partner dargestellt, dargestellt als Bedeutung der Beziehung. Dieses Modell unterscheidet fünf Hauptstrategien (Formen, Stile, Taktiken) des Verhaltens (Abb. 1)
Grundlegende Ansätze zur Konfliktlösung:
Gerät
Zusammenarbeit
Kompromiss
Vermeidung (Rückzug)
Rivalität
Minimales Interesse an beiden Achsen am Schnittpunkt bildet eine Vermeidungs-(Rückzugs-)Strategie; das Maximum entlang der vertikalen Achse bildet eine Befestigung; horizontal - Rivalität; Die Kombination aus maximalem Interesse auf beiden Achsen gewährleistet Kooperation und die Mittelposition entspricht einem Kompromiss.
Die Strategie (Taktik) des Verhaltens in einem bestimmten Konflikt wird dadurch bestimmt, inwieweit ein Kind seine eigenen Interessen, passiv oder aktiv, und die Interessen eines anderen, gemeinsam oder einzeln handelnd, befriedigen kann. Die Wahl der Verhaltensstrategie (Taktik) erfolgt unter dem Einfluss einer psychologischen Einstellung (Orientierung), die kognitive, motivierende und moralische Komponenten umfasst. Psychologische Orientierungen entstehen sowohl unter dem Einfluss der objektiven Merkmale der einzelnen Konfliktparteien als auch aufgrund individueller Merkmale des Einzelnen, die eine vorherrschende Tendenz zur Wahl bestimmter Interaktionsstrategien erkennen lassen.
Jedes Kind kann die betreffenden Verhaltensweisen in gewissem Umfang anwenden, in der Regel gibt es jedoch eine vorrangige Form. Amerikanische Psychologen schlagen vor, das Verhalten eines Kindes in einer Konfliktsituation aus der Perspektive solcher Strategien zu betrachten: „Glättung“, „Rückzug, Vermeidung“, „Konfrontation“ („Opposition, Konfrontation, Kollision“, „Rivalität“) und „Zwang“ ( „Beziehungen abbrechen“). Zur Interpretation nutzen sie Bilder von Tieren, für die bestimmte Verhaltensmerkmale charakteristisch sind – das sind ein Bärenjunges, eine Schildkröte, eine Eule, ein Fuchs und ein Hai.
Versuchen wir, anhand dieser Bilder die Formen (Strategien, Taktiken) des Verhaltens eines Kindes in einer Konfliktsituation zu vergleichen.
Strategie (Taktik) der „Konfrontation“ („Konkurrenz“, „Rivalität“)- In der Konfliktforschung und Sozialpsychologie wird diese Strategie als aktiver Kampf eines Individuums für seine Interessen unter Einsatz aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel zur Erreichung seiner Ziele betrachtet. Dieses Verhalten ist strikt auf den Gewinn ausgerichtet, unabhängig von den eigenen Verlusten, was durch den Ausdruck „Voraneilen“ definiert werden kann. Hier herrscht anhaltende Konfrontation, Rivalität und kompromisslose Verteidigung der eigenen Interessen. Diese Verhaltensform kann sich bei einem Menschen im Kindesalter aufgrund individueller psychologischer Merkmale des Einzelnen (Temperament, Ausdruck von Charaktereigenschaften etc.) sowie aufgrund der Bedingungen seiner sozialen Entwicklung (Familie, Kindergarten, Schule) ausbilden. Es ist zu beachten, dass Kinder im Vorschulalter diese Verhaltensstrategie häufig als Abwehrmechanismus nutzen, da ihnen die notwendigen Fähigkeiten für eine effektive Interaktion mit Gleichaltrigen und eine konstruktive Lösung einer Konfliktsituation fehlen.
Amerikanische Psychologen vergleichen das Verhalten eines Kindes, das die Strategie des Wettbewerbs und der Opposition nutzt, mit dem Verhalten einer Eule.
Diese Strategie manifestiert sich im Verhalten des Kindes:
In strenger Kontrolle der Handlungen des Feindes, Rivalen;
In der ständigen und absichtlichen Unterdrückung des Feindes mit allen verfügbaren Mitteln;
Durch den Einsatz von Täuschung, List und dem Versuch, eine Position einzunehmen, in der „alle Mittel gut sind“;
Den Gegner zu unüberlegten Reaktionen und Fehlern provozieren.
In der Kindheit können sich Persönlichkeitsmerkmale ausbilden wie: Orientierung am Bewahren des Bestehenden, Angst vor Innovation, zweideutige Entscheidungen, Angst vor Kritik am eigenen Verhalten, Wunsch nach Unterdrückung und Machterlangung, Ignorieren kollektiver Meinungen und Einschätzungen bei Entscheidungen in kritischen Situationen . Diese Persönlichkeitsmerkmale können sich durch den vorherrschenden Einsatz von Kampfstrategien verfestigen und in der Zukunft manifestieren.
Strategie (Taktik) „Vermeidung“ („Flucht“, „Ausweichen“)- Die Exit-Strategie ist durch den Wunsch gekennzeichnet, dem Konflikt zu entkommen. Der Konfliktgegenstand ist in dieser Situation weder für den einen noch für den anderen Beteiligten von besonderer Bedeutung. Amerikanische Forscher vergleichen diesen Verhaltensstil im übertragenen Sinne mit dem Verhalten einer Schildkröte. Sie ist gemächlich, ruhig, langsam und versucht bei Gefahr wegzukriechen oder ihren Kopf unter ihrem Panzer zu verstecken. In manchen Ländern gilt die Schildkröte als Symbol der Weisheit.
Bei der Beobachtung von Kindern in Konfliktsituationen fällt auf, dass einer der Rivalen oft stärker und durchsetzungsfähiger ist, während der andere schwächer ist. In der Regel gibt ein schwaches Kind seine Position an ein stärkeres ab oder versucht, dem Konflikt zu entkommen. In anderen Fällen ist es das, was ein Kind tut, für das der Konfliktgegenstand nicht wichtig ist. Darüber hinaus wird diese Verhaltensform gewählt, wenn das Kind seine Rechte nicht verteidigen, in einer Konfliktsituation nicht kooperieren möchte, seine Position nicht äußert oder einem Streit aus dem Weg geht. Dieses Verhalten ist möglich, wenn die Situation zu komplex ist und die Lösung des Konflikts von den Beteiligten viel Aufwand erfordert oder das Kind nicht über genügend Beharrlichkeit verfügt, um den Konflikt zu seinen Gunsten zu lösen. Der Vermeidungsstil kann bei inaktiven, ruhigen, zurückgezogenen Kindern beobachtet werden. Für sie ist es wichtig, Ruhe und Stabilität zu wahren und wiederherzustellen, statt den Konflikt zu lösen; Für solche Kinder ist das Thema der Meinungsverschiedenheit nicht bedeutsam oder das Geschehene stört sie nicht besonders. Sie glauben, dass es besser ist, gute Beziehungen zu anderen Kindern zu pflegen, als ihren eigenen Standpunkt zu verteidigen. Sie erkennen, dass die Wahrheit möglicherweise nicht auf ihrer Seite ist, und haben das Gefühl, dass sie nicht über die notwendigen Führungsqualitäten oder die Chance dazu verfügen gewinnen. Im Falle dieser Strategie ist es angebracht, sich an das Sprichwort zu erinnern: „Und die Wölfe werden gefüttert und die Schafe sind in Sicherheit.“
Es ist zu beachten, dass Kinder nicht immer aus freien Stücken am Konflikt beteiligt werden, sondern aufgrund der vorherrschenden Umstände zu dessen „Opfer“ werden können. Die Opferposition ist für manche Kinder aufgrund bestimmter kompensatorischer Faktoren attraktiv: Das Opfer erhält erhebliche Unterstützung von außen; sie haben großes Mitgefühl mit ihr; Sie muss nicht versuchen, das Problem selbst zu lösen, sie muss nicht die Verantwortung für die Folgen des Konflikts übernehmen, da andere dies für sie tun. Kinder, die die „Schildkröten“-Strategie anwenden, haben den inhärenten Wunsch, aus der „unheimlichen“ Situation herauszukommen, ohne auf sich selbst zu bestehen, ohne zu streiten und Einwände gegen den Gegner zu erheben. Die Rolle des Opfers und die Unfähigkeit des Kindes, sich daraus zu befreien, liegt in der entstehenden Haltung der Hilflosigkeit und der Unfähigkeit, die Situation zu ändern. Die Strategie des Verlassens und Vermeidens in einer Konfliktsituation kann dazu führen, dass die Situation nach innen getrieben wird und trägt zur Entwicklung eines Konflikts zwischen zwei Wünschen bei – der Aufrechterhaltung der Beziehung und dem Erreichen des Ziels. Und dieser Konflikt scheint sich auf eine andere Ebene zu verschieben, tiefer und komplexer zu werden. Und ein ungelöster Konflikt ist gefährlich für die Psyche des Kindes, weil er ins Unterbewusstsein verdrängt wird und sich in einer Zunahme der Angst bis hin zu somatischen Erkrankungen und neurotischen Störungen äußert.
Charakteristische Merkmale des Verhaltens eines Kindes in der Strategie „Flucht (Ausweichen)“:
Verweigert den Dialog und nutzt demonstrative Rückzugstaktiken;
Vermeidet den Einsatz gewaltsamer Techniken;
Versteht den Ernst und die Dringlichkeit der Situation nicht und leugnet sie;
Er zögert systematisch bei Entscheidungen, kommt immer zu spät, weil er Angst hat, eine Reaktion zu unternehmen. Dies ist eine Situation verpasster Chancen.
Persönliche Ressource: Zeitgefühl, Fähigkeit zum Innehalten, Ausdauer und Selbstbeherrschung.
Charakteristische Persönlichkeitseigenschaften:
Schüchternheit in der Kommunikation;
Ungeduld gegenüber Kritik – sie als Angriff auf sich selbst akzeptieren;
Unentschlossenheit in kritischen Situationen, handelt nach dem Prinzip „Vielleicht klappt es.“
Strategie (Taktik) des „Kompromisses“- Sein Kern liegt darin, dass die Parteien versuchen, Differenzen durch gegenseitige Zugeständnisse beizulegen. In dieser Hinsicht ähnelt es ein wenig dem Stil der Zusammenarbeit, wird jedoch auf einer oberflächlicheren Ebene durchgeführt, da die Parteien einander in gewisser Weise unterlegen sind. Ziel dieser Strategie ist es, eine Konfliktsituation zu lösen, um die positive Entwicklung zwischenmenschlicher Beziehungen aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.
Laut Psychologen zeichnet sich diese Strategie durch ein Verhalten aus, das Vorsicht, List, Höflichkeit und Schmeichelei vereint, was für einen Fuchs sehr charakteristisch ist. Gewicht, Gleichgewicht und Vorsicht sind die Hauptprinzipien dieses Verhaltens. Kinder, die diese Strategie anwenden, handeln nach dem Prinzip: „Ich gebe ein wenig nach, wenn du auch bereit bist, nachzugeben.“ Kompromiss setzt voraus, dass das Handeln der Konfliktparteien durch gegenseitige Zugeständnisse geregelt wird, die Entwicklung einer für beide Seiten passenden Zwischenlösung, bei der niemand wirklich gewinnt, aber auch niemand verliert. Darüber hinaus sind für das Kind sowohl persönliche Ziele als auch Beziehungen zu Gleichaltrigen gleichermaßen wichtig, deren Normalisierung es in jedem Fall anstrebt. Es ist zu beachten, dass für Kinder bei einer Kompromisslösung eines Problems die gleichmäßige Aufteilung der Verantwortung oder des Konfliktthemas oft als die gerechteste Lösung angesehen wird.
Das taktische Handeln des „Fuchses“ lässt sich nicht nur in Konflikten zwischen Kindern, sondern auch in ihren Beziehungen beobachten. Dieser kindliche Verhaltensstil äußert sich in:
In der Fähigkeit zu verhandeln, im Interesse an denen, die auch verhandeln können;
Im Einsatz von Täuschung und Schmeichelei, um die nicht sehr ausgeprägten Eigenschaften des Feindes hervorzuheben (Manipulation);
Wir konzentrieren uns auf die Gleichberechtigung beim Teilen und handeln nach dem Grundsatz: „Jede Schwester bekommt einen Ohrring.“
Persönlichkeitsressource:
Gute Orientierung in der Situation;
Ständige Analyse;
Spielstil des Verhaltens.
Grundlegende Ansätze zur Konfliktlösung Merkmale der Persönlichkeitsqualität:
Vorsicht bei der Beurteilung, Kritik, Vorwürfen gepaart mit Offenheit;
Vorsichtige Haltung gegenüber kritischen Einschätzungen anderer Menschen;
Erwarten Sie sanfte Formulierungen, schöne Worte.
Der Wunsch, dass andere ihre Gedanken nicht zu offen und harsch äußern.
Strategie (Taktik) „Anpassung“ („Compliance“, „Glättung“)- Ein charakteristisches Merkmal dieser Strategie ist, dass der Konfliktteilnehmer gemeinsam mit der anderen Seite agiert, aber nicht versucht, seine eigenen Interessen zu verteidigen, um die Atmosphäre zu glätten und ein günstiges Mikroklima in der Gruppe wiederherzustellen. Mit anderen Worten: Wer eine Konzessionsstrategie anwendet, misst seinen eigenen Interessen einen geringen Stellenwert bei und opfert sie zugunsten seines Gegners.
Der betreffende Stil erinnert ein wenig an den Evasion-Stil, ist es aber verschiedene Stile. Ihr Unterschied besteht darin, dass sich das Kind beim Ausweichen nicht an das andere Kind anpasst und nichts unternimmt, um seine Interessen zu befriedigen. Er entfernt sich einfach und „schiebt“ das Problem von sich weg. Er passt sich der Situation an, handelt gemeinsam mit seinem Altersgenossen und passt sich ihm gleichzeitig an, stimmt praktisch zu, das zu tun, was das andere Kind von ihm will. Bis zu einem gewissen Grad opfert das Kind seine Interessen und ändert seine Position zugunsten einer anderen Person.
Zur Verdeutlichung assoziieren Psychologen das Verhalten in der Strategie „Unterkunft“ und „Zugeständnis“ mit dem Verhalten eines Bärenjungen, das ein Gefühl von Wärme und Weichheit vermittelt. Mit anderen Worten: Das Kind orientiert sich an dem Verhaltensprinzip: „Was auch immer du willst, lass uns einfach zusammenleben.“ Diese Haltung des Wohlwollens ist auf Kosten der eigenen Verluste möglich. Hier ist es wichtig, die Kräfteverhältnisse der Gegner zu berücksichtigen. Wenn das Kräfteverhältnis nicht zugunsten einer der am Konflikt beteiligten Parteien ausfällt und diese kaum eine Chance auf einen Sieg hat und ein weiterer Kampf keinen Sinn ergibt, kann es sein, dass sich das Kind zu einer Haltung umorientiert, deren Motto „Ich gebe auf“ lautet der Gnade des Gewinners ausgeliefert.“ So nutzt das Kind die Strategie der „Anpassung“, des „Zugeständnisses“ in einem Konflikt, wenn die Situation für es nicht besonders bedeutsam ist und es wichtiger ist, gute Beziehungen zum Gegner aufrechtzuerhalten, als seine eigenen Interessen zu verteidigen.
Die Handlungen eines Kindes, die sich auf die Strategie der „Anpassung“ (Zugeständnis, Glättung) konzentrieren, sind wie folgt:
Systematische Übereinstimmung mit den Forderungen des Feindes, d. h. maximale Zugeständnisse (falls dies eine Taktik ist);
Demonstration von mangelndem Siegeswillen oder ernsthaftem Widerstand – wenn gesagt wird: „Ich brauche nichts!“, dann wird dies von anderen manchmal so wahrgenommen: „Ich brauche alles!“;
Druck auf das Gewissen, moralische Qualitäten;
Den Feind verwöhnen, Schmeichelei.
Setzt sich diese Verhaltensstrategie bei einem Kind durch, kann es in Zukunft zur Entwicklung eines generell konformistischen Verhaltensstils kommen, der mit einem Mangel an eigener Meinung einhergeht schwierige Situationen, der Wunsch, allen zu gefallen, niemanden zu beleidigen, damit es keine Zwietracht und Zusammenstöße gibt, Vermeidung dringende Probleme, Inkonsistenz in den Urteilen. Ein solches Kind kann unter den Einfluss von Anführern sozialer und asozialer Gruppen geraten und sein Verhalten kann manipuliert werden.
Strategie des „Erzwingens“ („Beziehungen abbrechen“)- Diese Strategie wird häufig von Vorschulkindern in einer Konfliktsituation als Reaktion auf die Handlungen eines Gegners eingesetzt, wodurch jeder ein Gefühl tiefer Ressentiments und Verletzung seiner eigenen Interessen verspürt.
Ausländische Forscher ziehen eine Analogie zwischen den taktischen Handlungen eines Kindes, die zu einem Beziehungsabbruch führen, mit den Verhaltensmerkmalen eines „Hai“. Der Hai zeichnet sich durch Angriffs-, Angriffs-, Unvorhersehbarkeits- und Überraschungstaktiken aus.
In einer realen Situation strebt ein Kind, insbesondere mit Anzeichen von Aggression, danach, auf sich allein gestellt zu bestehen, indem es offen für seine Interessen kämpft. Er übt starken Druck aus, kann bei Widerstand der anderen Seite eine harte Position unversöhnlichen Antagonismus einnehmen und auch Methoden anwenden wie: Druck auf den Gegner, Zwang, insbesondere wenn er die Abhängigkeit des anderen spürt, die Konfliktsituation wahrnimmt als Frage von Sieg oder Niederlage. Manchmal versucht er, seinen Gegner zu überschreien und auszunutzen körperliche Gewalt. Ein Kind, das seinen Groll zum Ausdruck bringt, schmollt möglicherweise und steht gleichzeitig unter moralischem Druck. Innerhalb dieses Stils überwiegen Versuche, den Gegner um jeden Preis zu zwingen, seinen Standpunkt zu akzeptieren, während das Kind sich nicht für die Meinungen anderer interessiert, sich normalerweise aggressiv verhält und seine Autorität und Rechte als Führungskraft nutzt, um andere Kinder zu beeinflussen. durch Zwang und manchmal durch Schreien und Weinen. Ein Erwachsener wendet diese Verhaltensstrategie an, wenn ihm das Konfliktthema sehr wichtig ist. Bei Kindern wird das Konfliktthema in der Regel nur unter Berücksichtigung ihrer eigenen Interessen betrachtet und die Interessen ihrer Mitschüler ignoriert, da eines der wichtigen Merkmale des Vorschulalters das Phänomen des Egozentrismus (d. h. der Unfähigkeit) ist sich in die Lage eines anderen versetzen). In diesem Fall kann sich die Konfliktsituation so verschärfen, dass der einzige Ausweg darin besteht, die Beziehung zwischen den Kindern abzubrechen, und dieser Beziehungsabbruch zeichnet sich in der Regel durch seine kurze Dauer aus („Ich bin keine Freunde“) bis zum Abend“, „Ich bin erst beim ersten interessanten Spiel befreundet ...“).
Im Gegensatz zu dem von einer Gruppe amerikanischer Psychologen entwickelten psychologischen Modell, das die Verhaltensstile von Kindern in Konfliktsituationen charakterisiert, betrachtet das Modell von K. Thomas die Strategie, die dem „Beziehungsabbruch“ entgegengesetzt ist – nämlich „Kooperation“. Der Autor hält es (im Kontext der Aufgabe) für angemessen, diese Taktik des „Kooperationsverhaltens“ zu berücksichtigen, die in Konfliktsituationen zwischen Kindern wirksam sein kann (sofern ihnen diese Strategie beigebracht wird) und verwendet das Bild eines Delphins zur Beschreibung und Interpretieren Sie diese Strategie.
Strategie (Taktik) der „Kooperation“- gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Fokussierung sowohl auf die eigenen Interessen als auch auf die Interessen des Gegners. Diese Strategie basiert nicht nur auf einem Interessenausgleich, sondern auch auf der Anerkennung des Wertes zwischenmenschlicher Beziehungen. Sie ist am schwierigsten zu analysieren, da sie alle anderen Strategien umfasst und den Wunsch der Kriegsparteien widerspiegelt, das entstandene Problem gemeinsam zu lösen. Natürlich ist es für Kinder im Vorschulalter sehr schwierig, Kooperationsfähigkeiten zu erlernen, da sie aufgrund ihrer Altersmerkmale einen Gleichaltrigen mit einer eigenen Innenwelt nicht als gleichberechtigten Kommunikations- und Aktivitätspartner wahrnehmen.
In einer bildlichen Darstellung des Verhaltens dieser Strategie kann man sich auf das Verhalten eines Delfins beziehen, der sich durch ein hohes Maß an Intelligenz sowie Rationalität und gesunden Menschenverstand auszeichnet.
Vorschulkinder, die in einem Konflikt ihre Position äußern und Widersprüche in ihren Interessen und denen ihres Gegners offen eingestehen können, sind selten. Ein kooperationsorientiertes Kind unterscheidet sich jedoch von anderen durch seine Fähigkeit, zu argumentieren, Schlussfolgerungen zu ziehen (manchmal werden sie „Oldies“ genannt) und eine Konfliktsituation und bestehende Widersprüche friedlich zu lösen. Gemeinsam mit anderen Konfliktbeteiligten und mit Hilfe eines Erwachsenen kann ein Kind in einer offenen Diskussion nicht nur zustimmen, sondern manchmal auch seine eigene Version einer gemeinsamen Lösung finden und anbieten, die alle vollkommen zufriedenstellt. Das Prinzip dieser Strategie lautet: „Lasst uns gegenseitige Missstände hinter uns lassen.“ Ich bevorzuge... Was ist mit dir? Das Kind, das die Strategie der „Kooperation“ anwendet, um seine Interessen zu befriedigen und seine eigenen Interessen zu verteidigen, muss gezwungen werden, die Bedürfnisse und Wünsche der anderen Partei zu berücksichtigen. Durch die Wahl dieser Strategie ähnelt das Kind in gewisser Weise einem Erwachsenen, der bereit ist, den Verhandlungsprozess zu führen, nach Alternativen zu suchen und den Konflikt konstruktiv zu lösen.
Besonderheiten des kindlichen Verhaltens in der Strategie „Kooperation“:
Beteiligt sich an der Diskussion des Problems, spricht dabei offen und wahrheitsgemäß über die Ursache des entstandenen Konflikts, verstellt sich nicht, schleicht sich nicht und beweist beharrlich, dass er mit der Bestimmung des Konfliktgegenstandes Recht hat;
Erhebt keinen Machtanspruch, sondern zeigt Führungsqualitäten, vergisst schnell Missstände und stellt freundschaftliche Beziehungen wieder her;
Kann Ratschläge von Gleichaltrigen und Erwachsenen annehmen und befolgen.
Diese Art der Interaktion setzt bei Kindern (nicht nur bei den Konfliktbeteiligten) eine bestimmte Verhaltenskultur voraus. Daher ist es sehr wichtig, Ihrem Kind von Kindheit an Kooperationstechniken beizubringen (um Ihre Wünsche erklären, Ihre Beschwerden äußern, einander zuhören und den Standpunkt des anderen respektieren zu können).
Das Senden Ihrer guten Arbeit an die Wissensdatenbank ist ganz einfach. Nutzen Sie das untenstehende Formular
Studierende, Doktoranden und junge Wissenschaftler, die die Wissensbasis in ihrem Studium und ihrer Arbeit nutzen, werden Ihnen sehr dankbar sein.
Veröffentlicht amhttp:// www. Alles Gute. ru/
Moskauer Bildungsministerium
ZustandBudgetlehrreichEinrichtunghöherFachmannAusbildungStädteMoskau
"MoskauurbanpädagogischUniversität"
Institut für Pädagogik und Bildungspsychologie
Abteilung für Pädagogische Psychologie des Allgemeinen Instituts
DIPLOMARBEIT
Entwicklung konfliktfreier Verhaltenskompetenzen bei Senioren Vorschulalter
Mokan Tatjana Wladimirowna
Spezialität - 031100 Pädagogik und Methoden der Vorschulerziehung
(außerordentliches Studium)
Wissenschaftlich Aufsicht: Dvoinin A.M. Kandidat für Psychologie, Assoc.
Moskau2013
Konflikt im Vorschulalter, Meinungsverschiedenheit, Gaming, psychologisch
Einführung
1. Theoretische Grundlagen zur Untersuchung der Problematik des Konfliktverhaltens bei Kindern im höheren Vorschulalter
1.1 Der Konfliktbegriff, seine psychologischen Merkmale und Entstehungsursachen
1.2 Merkmale kindlicher Konflikte im höheren Vorschulalter
1.3 Besonderheiten der geschaffenen Voraussetzungen für die Entwicklung konfliktfreier Verhaltensfähigkeiten bei Kindern
2. Experimentelle Untersuchung der Entwicklung konfliktfreier Verhaltensfähigkeiten durch Spielaktivitäten bei Kindern im höheren Vorschulalter
2.1 Ermittlung des Ausmaßes des Konfliktverhaltens bei Kindern im höheren Vorschulalter
2.2 Entwicklung konfliktfreier Verhaltensfähigkeiten bei älteren Vorschulkindern bei Spielaktivitäten
2.3 Bewertung der Wirksamkeit der Organisation von Spielaktivitäten zur Entwicklung konfliktfreier Verhaltensfähigkeiten
Abschluss
Referenzliste
Anwendungen
Einführung
Relevanz. Das Vorschulalter ist ein besonders wichtiger Zeitraum in der Bildung, da es sich um das Alter der ersten Persönlichkeitsbildung des Kindes handelt. Zu diesem Zeitpunkt entstehen in der Kommunikation des Kindes mit Gleichaltrigen recht komplexe Beziehungen, die die Entwicklung seiner Persönlichkeit maßgeblich beeinflussen. Das Wissen um die Besonderheiten der Beziehungen zwischen Kindern in einer Kindergartengruppe und die damit verbundenen Schwierigkeiten kann Erwachsenen eine ernsthafte Hilfestellung bei der Gestaltung der pädagogischen Arbeit mit Vorschulkindern sein.
Es liegt auf der Hand, dass die Kommunikation eines Kindes mit Gleichaltrigen ein besonderer Bereich seines Lebens ist, der sich deutlich von der Kommunikation mit Erwachsenen unterscheidet. Enge Erwachsene sind in der Regel aufmerksam und freundlich gegenüber dem Baby, sie umgeben es mit Wärme und Fürsorge und bringen ihm bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten bei. Bei Gleichaltrigen läuft alles anders. Kinder sind weniger aufmerksam und freundlich; sie sind normalerweise nicht sehr darauf bedacht, einander zu helfen, ihre Mitmenschen zu unterstützen und zu verstehen. Sie können dir ein Spielzeug wegnehmen oder dich beleidigen, ohne auf deine Tränen zu achten. Und doch bereitet die Kommunikation mit anderen Kindern einem Vorschulkind unvergleichliche Freude.
Der Fähigkeit, positive Beziehungen zu anderen aufzubauen, und ihrer Rolle bei der Persönlichkeitsentwicklung wird seit jeher große Bedeutung beigemessen. Dabei geht es um Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen und Möglichkeiten zu deren Überwindung besondere Aufmerksamkeit Lehrer und Psychologen, insbesondere wenn es um Kinder geht.
Im Vorschulalter entstehen Vorstellungen über Konflikte und Konfliktsituationen, deren Art das reale Verhalten eines Vorschulkindes in einem Konflikt maßgeblich bestimmt.
Die positive Bedeutung von Konflikten besteht darin, einem Vorschulkind seine eigenen Fähigkeiten zu offenbaren, den Einzelnen als Subjekt der Konfliktprävention, -bewältigung und -lösung zu aktivieren. In diesem Zusammenhang stellt sich das Problem, Formen und Methoden der Gestaltung von Bedingungen zu finden, um das konstruktive Potenzial von Konflikten bei Vorschulkindern maximal auszuschöpfen.
Konflikte zwischen Vorschulkindern haben ihre eigene spezifische Spezifität, die durch den gleichzeitigen Einfluss konflikterzeugender Faktoren unterschiedlicher Art und der Altersmerkmale von Vorschulkindern bestimmt wird. Die Praxis zeigt, dass die häufigste Art und Weise, Konflikte bei Vorschulkindern zu überwinden, darin besteht, aggressive und feindselige Erscheinungsformen zu neutralisieren, die Konfliktparteien zu trennen und konflikterzeugende Faktoren zu beseitigen. All dies sind Möglichkeiten, die Aktivität von Vorschulkindern selbst zu reduzieren.
Allerdings ist die Bereitschaft des Vorschulkindes dazu konstruktives Verhalten unter Konfliktbedingungen wird es unter besonderen Bedingungen gebildet, deren Schaffung Gegenstand der Arbeit von Lehrern ist, die mit den Methoden der persönlichen Entwicklung von Vorschulkindern vertraut sind.
Das Thema Konflikt und Konfliktinteraktion wird in der Pädagogik und Psychologie ausführlich behandelt. Viele in- und ausländische Forscher haben sich mit dem Problem von Konflikten im Vorschulalter befasst: L.S. Wygotski, D. B. Elkonin, Ya.L. Kolominsky, A.V. Zaporozhets und andere glauben, dass Konflikte im Vorschulalter am häufigsten beim Spielen entstehen, da es die Hauptaktivität von Vorschulkindern ist. Den gewonnenen Daten zufolge kommt es bei Kindern im höheren Vorschulalter zu Konflikten um die Verteilung der Spielrollen sowie um die Richtigkeit der Spielhandlungen.
Durch die Analyse der Forschung konnten wir einen Widerspruch zwischen der Notwendigkeit, Konfliktverhalten bei älteren Vorschulkindern im Kindergarten zu verhindern, und der unzureichenden Entwicklung geeigneter Bedingungen sowie dem Mangel an Wissen der Lehrer über Möglichkeiten zur Prävention von Konfliktverhalten bei älteren Vorschulkindern erkennen. Die Relevanz der Studie ergibt sich somit aus der Bedeutung des Problems der Prävention von Konfliktverhalten bei Kindern im höheren Vorschulalter.
Das Forschungsproblem besteht darin, wie man bei Kindern im höheren Vorschulalter Fähigkeiten zu konfliktfreiem Verhalten entwickeln kann.
ZielForschung- Ermittlung psychologischer und pädagogischer Bedingungen zur Prävention von Konfliktverhalten bei Kindern im höheren Vorschulalter.
Ein Objekt- Konfliktverhalten von Kindern im höheren Vorschulalter.
Artikel- psychologische und pädagogische Bedingungen, die dazu beitragen, Konfliktverhalten bei Kindern im Vorschulalter zu verhindern.
TheoretischBasis Die Untersuchung ergab Hinweise auf die hohe Anfälligkeit von Kindern für die psychologischen und pädagogischen Einflüsse von L.S. Wygotski, B.C. Mukhina, S.T. Jacobson; Theorie über das Wesen der Persönlichkeit K.A. Abulkhanov-Slavskoy, L.I. Bozhovich, A.N. Leontyeva, S.L. Rubinstein; Bestimmungen zur Entwicklung und Komplikation von Einstellungen, auf deren Grundlage die Möglichkeit einer Selbstregulierung des Verhaltens von A.V. entsteht. Ermolina, E.P. Ilyina, Ya. Z. Neverovich; Bestimmungen über das Wesen des Konflikts, die Ursachen seines Auftretens und Möglichkeiten zur Lösung A.A. Bodaleva, V.O. Ageeva, N. V. Grishina, N. I. Leonova, A.G. Zdravomyslova; Konflikttheorien: psychoanalytisch (S. Freud, A. Adler, E. Fromm); soziotrop (W. McDougall, S. Sigle); Verhalten (A. Bass, A. Bandura, R. Sears).
Hypothese Unsere Forschung basiert auf der Annahme, dass der Prozess der Entwicklung konfliktfreier Verhaltensfähigkeiten bei Kindern im höheren Vorschulalter durch die gezielte Schaffung der folgenden psychologischen und pädagogischen Bedingungen effektiv sein wird:
Den Komplex in der Arbeit mit Kindern nutzen interaktive Spiele zielt darauf ab, Zusammenhalt und Zusammenarbeit aufzubauen, effektive Kommunikationswege zu lehren, einen Anspruch auf soziale Anerkennung zu bilden und Konflikte bei Kindern zu lindern;
Konfliktsituationen mit Kindern durchspielen und Auswege modellieren;
Der Einsatz psychogymnastischer Studien in der Arbeit mit Kindern zielt darauf ab, Motive für positives Verhalten zu entwickeln.
Basierend auf der Relevanz, dem Zweck, dem Gegenstand und dem Thema der Studie haben wir Folgendes identifiziert Aufgaben:
1. Erweitern Sie den Begriff des Konflikts psychologische Merkmale und die Ursachen des Auftretens.
2. Identifizieren Sie die Merkmale von Kinderkonflikten im höheren Vorschulalter.
3. Führen Sie eine empirische Studie durch, um das Ausmaß des Konflikts bei Kindern im höheren Vorschulalter zu bestimmen.
4. Implementieren Sie in der Praxis ein Unterrichtssystem, um Fähigkeiten für konfliktfreies Verhalten bei Spielaktivitäten zu entwickeln.
5. Bestimmen Sie die Wirksamkeit des Unterrichtssystems zur Entwicklung von Fähigkeiten für konfliktfreies Verhalten bei Spielaktivitäten.
Bei der Betrachtung des Standes des untersuchten Problems wurden in der Praxis Folgendes verwendet: Methoden:
1. Theoretische Analyse der Literatur.
2. Methodik „Beobachtung im Spiel“ (A.I. Anzharova).
3. „Bilder“-Technik (Kalinina R.R.).
4. Quantitative und qualitative Analyse der gewonnenen Daten.
TheoretischBedeutung Wir haben einen pädagogischen Weg gefunden, Konfliktverhalten bei Kindern im höheren Vorschulalter durch speziell organisierte psychologische und pädagogische Bedingungen zu verhindern: den Einsatz eines Komplexes interaktiver Spiele in der Arbeit mit Kindern; Konfliktsituationen durchspielen und Auswege modellieren; der Einsatz psychogymnastischer Studien.
PraktischBedeutung Die Forschung liegt in der Möglichkeit, die pädagogischen Bedingungen zu organisieren, die wir von Vorschullehrern und -psychologen begründet haben Bildungsinstitutionen bei der Lösung von Problemen der Konfliktprävention bei Kindern im Vorschulalter.
Diese Arbeit besteht aus einer Einleitung, zwei Kapiteln, einem Fazit und einem Literaturverzeichnis.
BaseempirischForschung: GBOU Lyceum Nr. 1557. Schüler nahmen an der Studie teil Seniorengruppe Bei einer Teilnehmerzahl von 20 Personen beträgt das Alter der Kinder 5 bis 6 Jahre.
1. TheoretischGrundlagenstudierenProblemeKonfliktVerhaltenbeiKinderSeniorVorschuleAlter
1.1 KonzeptKonflikt,seinpsychologischcharakteristischUndUrsachenEntstehung
Konflikte gab es schon immer, zu allen Zeiten und zwischen allen Völkern. Das Wort Konflikt kommt vom lateinischen „conflictus“, was „Zusammenstoß“ bedeutet. Als wissenschaftlicher Begriff wird dieses Wort in der Psychologie in einem nahen, aber nicht identischen Sinne verwendet.
Die Verwendung des Begriffs „Konflikt“ findet sich in der Entwicklung von Problemen in der Persönlichkeitspsychologie im Allgemeinen, in der Medizin, in der Sozialpsychologie, in der Psychotherapie, in der Pädagogik und in der Politikwissenschaft. Konflikte werden von westlichen Psychologen vor allem im Sinne der Traditionen der psychoanalytischen Vorstellung vom Wesen des Individuums sowie aus der Perspektive der Kognitionspsychologie, aus der Verhaltensposition und aus der Position von Rollenansätzen betrachtet.
Solche Konflikttheorien sind auch bekannt als die Theorie des strukturellen Gleichgewichts von F. Haider, der strukturell-funktionale Ansatz von T. Parsons, die Theorie des sozialen Konflikts von L. Coser, die Theorie der Konfliktologie von W.F. Lincoln, kognitive Theorie von M. Deutsch, Theorie der Verhaltensstrategie in einer Konfliktsituation von K. Thomas. Aufgrund dieser Vielfalt an Theorien, die sich mit Konfliktproblemen befassen, schlagen die Autoren vor große Menge Definitionen dieses Konzepts, die von ihrer Sicht auf die Natur des Biologischen und Sozialen und von der Sichtweise des Konflikts als persönliches oder Massenphänomen usw. abhängen. Grishina N.V. Psychologie des Konflikts. St. Petersburg: Peter, 2000.
M.A. Robert und F. Tilman definieren Konflikte wie folgt: Es handelt sich um einen Schockzustand, eine Desorganisation im Verhältnis zur bisherigen Entwicklung. Konflikte sind ein Generator neuer Strukturen. Wie Sie leicht erkennen können, weist der letzte Satz dieser Definition auf die positive Natur von Konflikten hin und spiegelt die moderne Sichtweise wider, dass Konflikte in effektiven Organisationen nicht nur möglich, sondern auch wünschenswert sind. Antsupov A.Ya., Shipilov A.I. Konfliktologie. M., 1999.
Die Definition von J. von Neumann und O. Morgenstein lautet wie folgt: Konflikt ist die Interaktion zweier Objekte, die unvereinbare Ziele und Wege zur Erreichung dieser Ziele haben. Solche Objekte können als Personen, einzelne Gruppen, Armeen, Monopole, Klassen, soziale Institutionen usw. betrachtet werden, deren Aktivitäten auf die eine oder andere Weise mit der Festlegung und Lösung von Organisations- und Managementproblemen sowie mit Prognosen und Entscheidungen verbunden sind als Planung zielgerichteter Handlungen. Zaitsev A.K. Sozialer Konflikt in einem Unternehmen. Kaluga, 1993., p. 42.
K. Levin charakterisiert einen Konflikt als eine Situation, in der ein Individuum gleichzeitig von entgegengesetzt gerichteten Kräften ungefähr gleicher Stärke beeinflusst wird. In seinen Werken untersucht er sowohl intrapersonale als auch zwischenmenschliche Konflikte.
Aus rollentheoretischer Sicht wird unter Konflikt eine Situation unvereinbarer Erwartungen (Anforderungen) verstanden, denen eine Person in einer bestimmten Rolle ausgesetzt ist. Typischerweise werden solche Konflikte in Interrollenkonflikte, Intrarollenkonflikte und persönliche Rollenkonflikte unterteilt. Yurchuk V.V. Modernes Wörterbuch in Psychologie, Minsk, 2000.
In der Theorie des sozialen Konflikts von L. Coser ist Konflikt ein Kampf um Werte und Ansprüche aufgrund mangelnden Status, Macht und Mitteln, bei dem die Ziele der Gegner von ihren Rivalen neutralisiert, verletzt oder beseitigt werden. Der Autor konzentriert sich auf die positive Funktion von Konflikten – die Aufrechterhaltung eines dynamischen Gleichgewichts Soziales System. Wenn der Konflikt, so Coser, mit Zielen, Werten oder Interessen verbunden ist, die die Grundexistenz von Gruppen nicht berühren, dann ist er positiv. Wenn der Konflikt mit den wichtigsten Werten der Gruppe verbunden ist, ist er unerwünscht, da er die Grundlagen der Gruppe untergräbt und eine Tendenz zu ihrer Zerstörung mit sich bringt. Soziale Konfliktologie / Ed. EIN V. Morozova. M., 2002.
Der Begründer einer eigenständigen Richtung in der Konfliktforschung in der amerikanischen Soziologie und Sozialpsychologie – der Konfliktologie – W. F. Lincoln nähert sich der Betrachtung von Konflikten vom Standpunkt des gesunden Menschenverstandes und des Pragmatismus und hält an der folgenden Arbeitsdefinition von Konflikten fest: Konflikt ist das Verstehen, Vorstellung oder Angst mindestens einer Seite, dass ihre Interessen von der anderen Partei oder den anderen Parteien verletzt, verletzt und ignoriert werden. Und zwei oder mehr Parteien sind bereit zu kämpfen, um die Interessen der Rivalen zu erobern, zu unterdrücken oder zu zerstören, um ihre eigenen Interessen zu befriedigen. Im Wesentlichen handelt es sich bei einem Konflikt um einen Wettbewerb um die Befriedigung von Interessen, in der Tat um einen Interessenkonflikt.
In der russischen Psychologie ist die gebräuchlichste Definition die folgende: Konflikt ist eine Kollision gegensätzlicher, unvereinbarer Tendenzen im Bewusstsein eines Individuums, in zwischenmenschlichen Interaktionen oder zwischenmenschliche Beziehungen Einzelpersonen oder Personengruppen, die mit akuten negativen emotionalen Erfahrungen verbunden sind. Yurchuk V.V. Modernes Wörterbuch der Psychologie, Minsk, 2000, S. 347
Ein Konflikt ist also eine offene Konfrontation, ein Zusammenstoß zweier oder mehrerer Subjekte und Teilnehmer sozialer Interaktion, deren Ursachen unvereinbare Bedürfnisse, Interessen und Werte sind.
Je nach Ausprägungsform kommt es in allen Bereichen zu Konflikten öffentliches Leben. I.E. Vorozheikin, A.Ya. Kibanov, D.K. Zakharov zeichnet sich durch sozioökonomische, ethnische, interethnische, politische, ideologische, religiöse, militärische, soziale und alltägliche Aspekte aus. Konflikte zeichnen sich durch ihre Bedeutung für eine Gruppe von Menschen sowie durch die Art und Weise ihrer Lösung aus. Es gibt konstruktive und destruktive Konflikte. Konstruktive Konflikte zeichnen sich durch Meinungsverschiedenheiten aus, die grundlegende Aspekte und Probleme im Leben der Menschen betreffen und deren Lösung die Gruppe auf eine neue, höhere und effektivere Entwicklungsebene führt. Destruktive Konflikte führen zu negativen, oft destruktiven Handlungen.
Die Einteilung der Konflikte in Typen ist recht willkürlich; es gibt keine feste Grenze zwischen ihnen.
Die Ursachen für Konflikte sind vielfältig und bedingt durch unterschiedliche Interaktionssituationen zwischen Menschen. A.A. Bodalev argumentiert, dass der Konflikt im Allgemeinen durch drei Gruppen von Gründen verursacht wird:
Arbeitsprozess;
Psychologische Merkmale menschlicher Beziehungen, d. h. Vorlieben und Abneigungen, Handlungen des Führers;
Persönliche Identität der Gruppenmitglieder. Bodalev A.A. Persönlichkeit und Kommunikation. - M.: Pädagogik, 1983.
Laut E. Meliburda hängt das menschliche Verhalten in einer Konfliktsituation von folgenden psychologischen Faktoren ab:
· Aktivität der Konfliktwahrnehmung;
· Offenheit und Effektivität der Kommunikation, Bereitschaft zur Problemdiskussion;
· Fähigkeit, eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens und der Zusammenarbeit zu schaffen;
· angemessene Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten;
· Wunsch zu dominieren;
· Konservatismus des Denkens, der Ansichten;
· Integrität und Geradlinigkeit der Aussagen;
· eine Reihe emotionaler Eigenschaften einer Person. Meliburda E. Ich-Du-Wir. Fortschritt, 1986.
Die Ursachen für Konflikte sind so vielfältig wie die Konflikte selbst. Aufgrund ihrer Quellen und Ursachen werden Konflikte in objektive und subjektive Konflikte unterteilt. Zu den objektiven Faktoren gehört der natürliche Interessenkonflikt der Menschen im Lebensprozess. Die wesentlichen subjektiven Gründe sind die subjektive Einschätzung des Verhaltens des Partners als inakzeptabel, geringe Konfliktresistenz, mangelnde Empathieentwicklung etc. Laut V.Ya. Zengenidze sollte zwischen objektiven Gründen und ihrer Wahrnehmung durch den Einzelnen unterscheiden. Objektive Gründe können ziemlich konventionell in Form mehrerer verstärkter Gruppen dargestellt werden:
Begrenzte Ressourcen, die verteilt werden müssen;
Unterschiede in Zielen, Werten, Verhaltensweisen, Qualifikationsniveau, Bildung;
Schlechte Kommunikation;
Interdependenz der Aufgaben, falsche Verteilung der Verantwortlichkeiten.
Gleichzeitig sind objektive Gründe nur dann Konfliktursachen, wenn sie es einem Einzelnen oder einer Gruppe unmöglich machen, ihre Bedürfnisse zu verwirklichen und persönliche oder Gruppeninteressen zu beeinträchtigen. Ya.A. Antsupov, A.I. Shepilov argumentiert, dass die Ursachen von Konflikten objektiv-subjektiver Natur sind und in vier Gruppen zusammengefasst werden können: objektive, organisatorische und verwaltungstechnische, sozialpsychologische, persönliche.
Zu den objektiven Ursachen von Konflikten A.Ya. Antsupov betrachtet den natürlichen Interessenkonflikt der Menschen im Verlauf ihrer Lebensaktivitäten. Typische sozialpsychologische Konfliktursachen sind Informationsverlust und -verzerrung im Prozess der zwischenmenschlichen Kommunikation sowie Ungleichgewichte im Rolleninteraktionsverhalten von Menschen. Antsupov A.Ya., Shpilov A.I., Konfliktologie. - M.: Einheit, 2000.
Die wichtigsten persönlichen Konfliktursachen laut A.I. Shipilov sind: subjektive Einschätzung des Verhaltens eines Partners als inakzeptabel, geringe Konfliktresistenz, schlechte Entwicklung von Empathie und unzureichendes Anspruchsniveau.
Die Grundlage jedes Konflikts ist eine Konfliktsituation – eine versteckte oder offene Konfrontation zwischen zwei oder mehr Beteiligten, die entweder widersprüchliche Positionen der Parteien zu einem beliebigen Thema oder gegensätzliche Ziele oder Mittel zu deren Erreichung unter bestimmten Bedingungen oder eine Interessendivergenz umfasst, Wünsche und Neigungen der Gegner. Eine Konfliktsituation entsteht in der Regel in Beziehungen und reift in praktischen Aktivitäten; ihre Entstehung wird durch eine mehr oder weniger lange Zeit versteckter oder einseitiger Unzufriedenheit begünstigt. Eine Konfliktsituation entsteht sowohl objektiv, außerhalb der Wünsche der Menschen, aufgrund der vorherrschenden Umstände, als auch subjektiv, aufgrund der bewussten Bestrebungen der gegnerischen Parteien. Es kann eine gewisse Zeit (meist in offener Form) bestehen bleiben, ohne dass es zu einem Zwischenfall kommt und sich somit nicht in einen offenen Konflikt verwandelt. Royak A.A. Psychologische Konflikte und Merkmale der individuellen Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes. M., 1988.
Damit ein Konflikt entsteht, ist ein Vorfall notwendig – hierbei handelt es sich um praktische Konflikthandlungen der Beteiligten (Parteien) einer Konfliktsituation, die sich durch kompromissloses Handeln auszeichnen und auf die zwingende Beherrschung des Gegenstandes des erhöhten Gegeninteresses abzielen. Ein Vorfall ereignet sich in der Regel nach einer scharfen Eskalation eines Widerspruchs oder wenn eine der Parteien beginnt, gegen die andere zu verstoßen und einen Konflikt provoziert. Beginnt die Gegenseite zu handeln, verwandelt sich der Konflikt vom Potenzial in die Realität. Konfliktsignale sind: Beziehungskrise, Spannung in der Kommunikation, allgemeines Unwohlsein.
In der Dynamik der Konfliktentwicklung gibt es mehrere Phasen: Die präsumtive Phase ist mit der Entstehung von Bedingungen verbunden, unter denen ein Interessenkonflikt entstehen kann. Zu diesen Bedingungen gehören: a) ein langfristig konfliktfreier Zustand eines Kollektivs oder einer Gruppe, wenn sich jeder für frei hält, keine Verantwortung gegenüber anderen trägt, früher oder später der Wunsch aufkommt, nach Verantwortlichen zu suchen; Jeder denkt an sich selbst rechte Seite zu Unrecht beleidigt wird, führt es zu Konflikten; eine konfliktfreie Entwicklung ist mit Konflikten behaftet; b) ständige Überarbeitung durch Überlastung, die zu Stress, Nervosität, Erregbarkeit und unzureichender Reaktion auf die einfachsten und harmlosesten Dinge führt; c) Informations- und Sinneshunger, Mangel an Vitalstoffen wichtige Informationen, längeres Fehlen heller, starker Eindrücke; Im Mittelpunkt steht die emotionale Übersättigung des Alltags. d) unterschiedliche Fähigkeiten, Möglichkeiten, Lebensbedingungen – all dies führt zu Neid auf einen erfolgreichen, fähigen Menschen. e) Art der Lebensorganisation und Führung eines Teams.
Das Stadium der Entstehung eines Konflikts ist ein Interessenkonflikt verschiedener Gruppen oder Einzelpersonen. Es ist in drei Hauptformen möglich: a) ein grundlegender Konflikt, bei dem die Befriedigung einiger definitiv nur durch Verletzung der Interessen anderer erreicht werden kann; b) ein Interessenkonflikt, der nur die Form der Beziehungen zwischen Menschen betrifft, ihre materiellen, spirituellen und sonstigen Bedürfnisse jedoch nicht ernsthaft beeinträchtigt; c) Es entsteht die Idee eines Interessenkonflikts, es handelt sich jedoch um einen imaginären, scheinbaren Konflikt, der die Interessen von Personen und Teammitgliedern nicht berührt.
Das Reifestadium des Konflikts – ein Interessenkonflikt wird unvermeidlich. In dieser Phase wird die psychologische Einstellung der Teilnehmer des sich entwickelnden Konflikts gebildet, d.h. eine unbewusste Bereitschaft, auf die eine oder andere Weise zu handeln, um die Ursachen eines unangenehmen Zustands zu beseitigen. Ein Zustand psychischer Anspannung fördert einen „Angriff“ oder einen „Rückzug“ vor der Quelle unangenehmer Erfahrungen. Die Menschen um Sie herum können einen heranreifenden Konflikt schneller erraten als seine Teilnehmer; sie haben unabhängigere Beobachtungen und Urteile, die freier von subjektiven Einschätzungen sind. Auch die psychologische Atmosphäre eines Teams oder einer Gruppe kann ein Hinweis auf die Reife eines Konflikts sein.
Die Phase des Konfliktbewusstseins – die Konfliktparteien beginnen, einen Interessenkonflikt zu erkennen und nicht nur zu spüren. Hier sind mehrere Optionen möglich: a) beide Beteiligten kommen zu dem Schluss, dass die widersprüchliche Beziehung unangemessen ist und sind bereit, auf gegenseitige Ansprüche zu verzichten; b) einer der Beteiligten versteht die Unvermeidlichkeit des Konflikts und ist nach Abwägung aller Umstände bereit, nachzugeben; ein anderer Teilnehmer gerät in eine weitere Verschlimmerung; betrachtet die Compliance der anderen Partei als Schwäche; c) beide Beteiligten kommen zu dem Schluss, dass die Widersprüche unüberbrückbar sind und beginnen, Kräfte zu mobilisieren, um den Konflikt zu ihren Gunsten zu lösen.
Nachdem wir das Konzept des Konflikts und die Gründe für sein Auftreten untersucht haben, können wir daher zu dem Schluss kommen, dass Konflikt eine Form der sozialen Interaktion zwischen zwei oder mehr Subjekten ist, die aufgrund einer Divergenz von Wünschen, Interessen, Werten oder Wahrnehmungen entsteht. Die wichtigsten persönlichen Konfliktursachen sind: subjektive Einschätzung des Verhaltens des Partners als inakzeptabel, geringe Konfliktresistenz, mangelnde Empathieentwicklung und unzureichendes Anspruchsniveau. Konflikte können psychologischer und pädagogischer Natur sein. Konflikte zeichnen sich durch ihre Bedeutung für eine Gruppe von Menschen sowie durch die Art und Weise ihrer Lösung aus. Es gibt konstruktive und destruktive Konflikte. Schauen wir uns die Besonderheiten von Kinderkonflikten im höheren Vorschulalter genauer an.
1.2 BesonderheitenKinder-KonflikteVSeniorVorschuleAlter
Im Vorschulalter ist das Rollenspiel die Hauptaktivität, und Kommunikation wird zu seinem Teil und seiner Voraussetzung. Aus Sicht von D.B. Elkonin: „Spiel ist seinem Inhalt, seiner Natur und seinem Ursprung nach sozial, das heißt, es entsteht aus den Bedingungen des Lebens eines Kindes in der Gesellschaft.“ Spezielle Bedeutung Für die Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes, für seine Aneignung elementarer moralischer Normen haben sie Beziehungen zum Spiel, da hier die erlernten Normen und Verhaltensregeln gebildet und tatsächlich manifestiert werden, die die Grundlage für die moralische Entwicklung von bilden Der Vorschulkind bildet die Fähigkeit, in einer Gruppe von Gleichaltrigen zu kommunizieren. Grundlagen der Kommunikation: Programm zur Entwicklung der Persönlichkeit eines Kindes, Kommunikationsfähigkeiten mit Erwachsenen und Gleichaltrigen - St. Petersburg: Bildung, 1995.-195 S.)
Eine Konfliktsituation entwickelt sich erst zu einem Konflikt, wenn Kind und Gleichaltrige gemeinsam handeln. Eine ähnliche Situation entsteht in Fällen, in denen ein Widerspruch besteht: zwischen den Anforderungen von Gleichaltrigen und den objektiven Fähigkeiten des Kindes im Spiel (letztere fallen geringer aus als die Anforderungen) oder zwischen den Leitbedürfnissen des Kindes und der Gleichaltrigen. In beiden Fällen handelt es sich um die Unreife der führenden Spielaktivität von Vorschulkindern, die zur Entwicklung psychischer Konflikte beiträgt.
Die Gründe können die mangelnde Initiative des Kindes beim Aufbau von Kontakten zu Gleichaltrigen oder das Fehlen emotionaler Bestrebungen zwischen den Spielern sein, wenn beispielsweise der Wunsch, Befehle zu erteilen, das Kind dazu veranlasst, das Spiel mit einem Lieblingsfreund zu verlassen und mit einem weniger guten Freund zu spielen angenehmer, aber nachgiebiger Gesprächspartner und mangelnde Kommunikationsfähigkeiten. Als Ergebnis solcher Interaktionen können zwei Arten von Widersprüchen entstehen: eine Diskrepanz zwischen den Anforderungen von Gleichaltrigen und den objektiven Fähigkeiten des Kindes im Spiel und eine Diskrepanz in den Motiven des Spiels zwischen Kind und Gleichaltrigen.
Antsupov A.Ya. identifiziert sieben Hauptgründe für Konflikte im Spiel:
1. „Spielzerstörung“ – dazu zählen solche Handlungen von Kindern, die den Spielablauf unterbrechen oder erschweren, zum Beispiel die Zerstörung von Spielstrukturen, Spielumgebungen sowie einer imaginären Spielsituation.
2. „Über die Wahl des allgemeinen Spielthemas“ – in diesen Fällen entsteht der Streit darüber, was für ein gemeinsames Spiel die Kinder spielen werden.
3. „Über die Zusammensetzung der Spielteilnehmer“ – hier wird die Frage entschieden, wer genau dieses Spiel spielen wird, d. h. wer in das Spiel einbezogen und wer ausgeschlossen werden soll.
4. „Wegen der Rollen“ – diese Konflikte entstehen hauptsächlich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zwischen Kindern darüber, wer die attraktivste oder umgekehrt unattraktivste Rolle spielen wird.
5. „Wegen Spielzeug“ – dazu gehören Streitigkeiten über den Besitz von Spielzeug, Spielgegenständen und Attributen.
6. „Über die Handlung des Spiels“ – in diesen Fällen streiten sich die Kinder darüber, wie und in welcher Art das Spiel gespielt werden soll Spielsituationen, Charaktere und was die Aktionen bestimmter Charaktere sein werden.
7. „Über die Richtigkeit von Spielhandlungen“ – dabei handelt es sich um Streitigkeiten darüber, ob sich dieses oder jenes Kind im Spiel richtig oder falsch verhält.
Die erhaltenen empirischen Daten bestätigen die Beschreibung von D.B. Elkonin-Dynamik: Bei jüngeren Kindern kommt es am häufigsten zu Konflikten wegen Spielzeug, bei Kindern mittleren Alters – wegen Rollen und bei älteren Kindern – wegen der Spielregeln. Antsupov A.Ya., Shpilov A.I., Konfliktologie. - M.: Einheit, 2000.
So spiegeln die Gründe für die Auseinandersetzungen zwischen Kindern ihre altersbedingte Entwicklung wider, wenn sie allmählich vom Streit um Spielzeug zu echten Diskussionen darüber übergehen, wie richtig sich dieses oder jenes Kind beim Spiel verhält.
Im Vorschulalter verändert sich die Spielmotivation, was den Inhalt des kindlichen Bedürfnisses nach einem Gleichaltrigen maßgeblich beeinflusst und das Interesse des Kindes an einem Gleichaltrigen als Träger menschlicher, persönlicher Qualitäten entsteht erst gegen Ende des Vorschulalters. Aktivitäten und Beziehungen von Vorschulkindern / Ed. T. A. Repina. M., 1987.
Bei jüngeren Vorschulkindern zeigt sich das Bedürfnis nach einem Gleichaltrigen, sich mit ihm zu vereinen, in Form eines Bedürfnisses nach ihm als Spielpartner. Dies ist genau das Stadium in der Entwicklung dieses Bedürfnisses, in dem das Kind einen Gleichaltrigen aus rein praktischen, nicht kommunikativen Gründen braucht – um den akuten Wunsch zu befriedigen, wie Erwachsene zu handeln und sich zu verhalten. In diesem Zeitraum (4 Jahre) wird die Beherrschung der Spielabläufe zur wichtigsten und definierenden Anforderung an einen Peer.
Die Rolle von Spielfähigkeiten ist so wichtig, dass Kinder oft ein unhöfliches, selbstsüchtiges, aber „interessant spielendes“ Kind einem freundlichen, sympathischen, aber unattraktiven spielenden Kind vorziehen. Dies bedeutet nicht, dass jüngere Vorschulkinder die persönlichen Qualitäten ihrer Partner noch nicht einschätzen können.
In diesem Alter können die meisten Kinder ihre Kameraden recht objektiv hinsichtlich der für die gemeinsame Zusammenarbeit wichtigen Eigenschaften wie Freundlichkeit, Verträglichkeit usw. charakterisieren.
Und dennoch ein Peer, wie in den Studien von A.A. erwähnt. Royak ist für das Kind in dieser Zeit vor allem im Hinblick auf seine Spielqualitäten notwendig: Das Spiel bekommt in dieser Phase eine besondere persönliche Bedeutung. Gleichaltrige vermeiden besonders aktiv den Kontakt mit einem Kind, dessen unzureichende Entwicklung der Spielfähigkeiten mit Unwissenheit über positive Formen der Zusammenarbeit einhergeht, da es sich ständig in Spiele einmischt, deren Umsetzung stört und unabsichtlich von Kindern geschaffene Gebäude zerstört. Royak A.A. Psychologische Konflikte und Merkmale der individuellen Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes. M., 1988.
Nicht weniger aktiv wird ein Kind von Gleichaltrigen abgelehnt, wenn es über unzureichende Kenntnisse über Methoden der Zusammenarbeit verfügt, die einerseits bei übermäßig aktiven Kindern zu finden sind, die ihr Verhalten nicht zu kontrollieren wissen, obwohl sie über spielerische Fähigkeiten verfügen und positive Methoden der Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite handelt es sich um langsame Kinder, die nicht wissen, wie sie die im Spiel notwendige Handlungsdynamik entwickeln sollen, wodurch ihre Altersgenossen ihnen trotz der Spielfähigkeit und der freundlichen Einstellung dieser Kinder buchstäblich davonlaufen ihre Partner.
Ohne die Möglichkeit, sich voll am Spiel zu beteiligen, können solche Kinder ihr eigenes dringendes Bedürfnis nach gemeinsamem Spielen nicht befriedigen, was letztendlich zu einem tiefen psychologischen Konflikt mit Gleichaltrigen führt.
Durch die Entstehung einer Konfliktsituation zwischen Kind und Gleichaltrigen wird die mangelnde Entwicklung spielerischer Fähigkeiten in der Spielinteraktion der Kinder deutlich und führt zu einer Diskrepanz (Widerspruch) zwischen den Anforderungen der Partner und den objektiven Fähigkeiten des Kindes im Spiel . Beobachtungen zeigen jedoch, dass ein Scheitern im Spiel die Unfähigkeit, ein vollwertiger Teilnehmer zu werden, bedeutet lange Zeit mindern nicht die effektive, aktive Natur des Bedürfnisses selbst.
Ab der zweiten Hälfte des mittleren Vorschulalters beginnen Kinder zu klagen, dass sie „sie nicht spielen lassen“, was die Verletzung eines Grundbedürfnisses des Kindes widerspiegelt. Dies ist das erste Symptom des Bewusstseins für das eigene Unwohlsein, für die Unfähigkeit, voll am Spiel teilzunehmen. In dieser Zeit kommt es zu Verweigerungen des Kindergartenbesuchs, einhergehend mit einem spürbaren Rückgang der Aktivität bei der Kontaktaufnahme, einem allmählichen Rückzug von Gleichaltrigen und einer Verschlechterung der Stimmung.
Das Bewusstsein für Schwierigkeiten im Spiel, in einer für einen Vorschulkind so wichtigen „Angelegenheit“, löst in ihm tiefe Gefühle aus, die aufgrund der hohen Emotionalität dieses Alters, des Wunsches nach Anerkennung und Anerkennung seiner Verdienste, besonders akut werden. Und ohne es zu erhalten, versucht das Kind auf jede erdenkliche Weise, sich vor einer akuten konflikttraumatischen Situation zu schützen, zieht sich immer mehr in sich selbst zurück und entfernt sich allmählich von seinen Altersgenossen.
Die Haltung ihnen gegenüber bleibt jedoch freundlich. Das Verständnis für das eigene Scheitern im Spiel über einen längeren Zeitraum hinweg ändert nichts an der persönlichen Einstellung des Kindes gegenüber Kindern.
Eine Verzerrung der Einstellungen gegenüber Gleichaltrigen tritt viel später, gegen Ende des mittleren Vorschulalters, auf und weist auf den Beginn einer neuen Phase in der Entwicklung des Konflikts hin.
Wie von A.N. Leontyev kann das Kind selbst nicht aus einer akut ungünstigen Situation herauskommen; seine Erfahrungen werden zunehmend verallgemeinert, vertieft und verschärft. Dadurch erhalten die Handlungen von Gleichaltrigen in seinen Augen eine negative Konnotation, wirken immer unfairer und verursachen beim Kind einen angespannten affektiven Zustand, der in offenem emotionalem Protest, in negativen Verhaltensreaktionen (erhöhte Sensibilität, Sturheit, Misstrauen, Unhöflichkeit, Bitterkeit, sogar Elemente Aggression), was auf eine qualitative Veränderung der Einstellung gegenüber Kindern und der gesamten Richtung seines Verhaltens hinweist . Leontyev A.N. Ausgewählte psychologische Werke: In 2 Bänden – Bd. II. - M., 1983.
Die negative Einstellung von Gleichaltrigen trägt zur Bildung einer falschen Vorstellung des Kindes über sich selbst, zu einem starken Rückgang des Selbstwertgefühls und des Anspruchsniveaus bei. Erfolg im Spiel ist für ein Kind in diesem Alter so bedeutsam, dass sein Fehlen zu einem Rückgang der wichtigsten Persönlichkeitsformationen – dem Anspruchsniveau und dem damit verbundenen Selbstwertgefühl – und zu einer Verzerrung des kindlichen Selbstbewusstseins führt.
Erfahrungen tragen wesentlich zur Entstehung qualitativer Veränderungen im Verhalten eines Kindes, in seiner Einstellung zu Kindern, zu sich selbst bei: von impulsiven, unbewussten emotionalen Reaktionen bis hin zu bewussten, tiefen, intensiven affektiven Zuständen, die die Einstellung des Vorschulkindes zu sich selbst verzerren und letztendlich seine insgesamt positive Einstellung. Nachdem die offene Bühne entstanden ist, entwickelt sich der Konflikt, der „gegenseitig“ und zwischenmenschlich geworden ist, weiter und eskaliert.
Ein ähnlicher Konflikt mit Gleichaltrigen entsteht, wenn ein Kind über spielerische und positive Fähigkeiten verfügt persönliche Qualitäten, können diese aufgrund der Unzulänglichkeit der Kooperationsmethoden nicht umsetzen. Die Hauptgründe in diesem Fall können im Übermaß liegen Motorik oder im Gegenteil, die Langsamkeit der Handlungen des Kindes.
Besonders negativ gestaltet sich die Situation des Scheiterns bei übererregbaren Kindern: Negative Verhaltensreaktionen, die durch psychische Konflikte mit Gleichaltrigen entstehen, nehmen oft einen neurotischen Charakter an.
Ein akuter Konflikt mit Gleichaltrigen, gefolgt von der Entfremdung des Kindes von der Kindergruppe, wird auch dann beobachtet, wenn das Kind, nachdem es Spielfähigkeiten und Methoden der Zusammenarbeit beherrscht, diese Fähigkeiten nur teilweise erkennt und in seinen Handlungen ständig hinter seinen Altersgenossen zurückbleibt. Aufgrund der übermäßigen Langsamkeit sind solche Kinder nicht in der Lage, die im Spiel erforderliche Handlungsdynamik zu erreichen. Dadurch gibt es keine langfristigen Kontakte zu Kindern.
Kalinina R.R. stellt fest, dass die Diagnose psychologischer Konflikte bei Vorschulkindern sehr wichtig ist frühe Stufen seine Entwicklung. Nur zu diesem Zeitpunkt kann es korrigiert werden: Das Erlernen solcher Kinder in Spielfähigkeiten, die Verbesserung ihrer Art und Weise, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen, verbunden mit einer Neuorientierung der vorherrschenden Meinungen von Gleichaltrigen, eine weitere Organisation der Spielinteraktion kann das Selbstvertrauen und eine freudige Stimmung wiederherstellen Erhöhen Sie die Initiative zur Kontaktaufnahme . Kalinina R.R. Persönliches Entwicklungstraining für Vorschulkinder: Aktivitäten, Spiele, Übungen. St. Petersburg: Rech, 2001.
Die Analyse von Fällen psychologischer Konflikte zwischen einem Kind und Gleichaltrigen zeigt, dass die Ursache nicht nur in unformierten Abläufen, sondern auch in einigen Verzerrungen in den Motiven des Spiels liegen kann.
Im Vorschulalter, aufgrund der erheblichen Komplikation von Aktivitäten, dem Aufkommen von Rollenspielen, der Notwendigkeit, die Meinungen von Gleichaltrigen zu berücksichtigen, in der Lage zu sein, seine unmittelbaren Wünsche zu verwalten und sie mit den Wünschen anderer Kinder zu koordinieren, die Die Motivationssphäre des Kindes verändert sich erheblich.
Es entsteht eine Hierarchie von Motiven, die wiederum einen qualitativ anderen, einzigartigen Charakter erhalten: Es treten indirekte, soziale Bedürfnisse auf, die durch bewusst akzeptierte Absichten und Ziele die Aktivitäten des Kindes entgegen seinen unmittelbaren Wünschen anregen können.
Allerdings haben die erlernten Normen nicht immer die nötige Motivationskraft für das Kind und bestimmen nicht in allen Fällen sein Verhalten. Darüber hinaus gibt es bereits in diesem Alter häufig Fälle, die auf eine Verzerrung der Motivation des Kindes hinweisen, auf das Vorherrschen unmenschlicher, egoistischer Motive, die oft mit einem niedrigen moralischen Entwicklungsstand einhergehen.
Besonders ausgeprägt sind egoistische Tendenzen im Verhalten von Kindern mit autoritären Motiven, insbesondere solchen, die in den ersten Rollen nach absoluter Durchsetzung im Spiel streben. Diese Tendenzen werden noch deutlicher, wenn es einem solchen Kind gelingt, seine Führungsposition zu etablieren.
Ein autoritärer Anführer ist ein Kind, dessen Spielführung auf den Prinzipien der Dominanz und Unterwerfung basiert. Ein solches Kind, das aktiv nach Spiel strebt, wird eigentlich nur von dem Bedürfnis nach Selbstbestätigung angetrieben. Die allgemeine Formel zur Motivation von Kinderspielen – „nicht gewinnen, sondern spielen“ – erweist sich hier als verzerrt: nicht spielen, sondern gewinnen, seinen Platz als Hauptdarsteller verteidigen. Deshalb schließen sie sich lieber mit wenig initiativen, konformistischen Kindern der Gruppe zusammen, die freiwillig Nebenrollen übernehmen, wenn es keine Möglichkeit zum „Diktieren“ gibt.
Mit einer unfreundlichen Haltung gegenüber seinen Spielpartnern erlebt der autoritäre Anführer ein positives emotionales Wohlbefinden: Er kommuniziert hauptsächlich mit konformistischen Kindern und bestätigt ständig seine egoistischen Bestrebungen. Die Zufriedenheit mit seiner Situation zeigt sich in solchen Fällen am hohen Selbstwertgefühl und Anspruchsniveau des Kindes, an seinem „sachlichen Auftreten“, am Ton, in dem es mit seinen Spielpartnern spricht, an seiner allgemeinen Fröhlichkeit und Aktivität. Somit gibt es keine inneren Widersprüche – der Wunsch, andere zu unterdrücken, steht voll und ganz im Einklang mit den moralischen Gefühlen und Überzeugungen eines solchen Kindes: Es ist besser als andere, da es ein Kommandant ist. Ein solches inneres „Wohlbefinden“ hat jedoch stattgefunden in gewissem Sinne unmoralischer Charakter, da er auf dem Wunsch beruht, andere zu unterdrücken. Koch I.A. Konflikte und ihre Regulierung. Jekaterinburg, 1997.
Da ein solcher Anführer in der Regel von Kindern gespielt wird, die freiwillig „zweite“ Rollen übernehmen, sehen solche Assoziationen äußerlich recht günstig aus. Aber die Ergebnisse der Studie von Prygin B.D. Erlauben Sie uns, über die Existenz eines tiefen psychologischen Konflikts im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen von Kindern zu sprechen. Dies wird durch das Fehlen jeglicher bestätigt gegenseitige Sympathie, niedrige Bewertungen, die Kinder den verschiedenen Fähigkeiten und Qualitäten des anderen geben, obwohl sie mehrere Jahre lang zusammen spielen können. Beziehungen zwischen Gleichaltrigen in Kindergartengruppen. /Hrsg. Repina T.A. - M.: Pädagogik - 1978
Faupel K. stellt fest, dass das Vorhandensein zweier solcher widersprüchlicher Pläne für die Beziehungen von Kindern mit einer autoritären Art der Spielführung: einer – äußerlich, wohlhabend, der andere – zutiefst widersprüchlich – eine ernsthafte Gefahr sowohl für die Persönlichkeitsentwicklung des Leiters als auch für ihn darstellt seine Partner. Fopel K. Wie man Kindern die Zusammenarbeit beibringt. Psychologische Spiele und Übungen: Ein praktischer Leitfaden. - Genesis, 2003.
Durch die Unterstützung seiner selbstsüchtigen Bestrebungen wird ein solcher „Diktator“ mit der Zeit noch autoritärer, überzeugter von seiner besonderen Bedeutung, psychologisch „taub“ gegenüber den Bitten und Vorschlägen seiner Partner, und sein Verhalten wird dementsprechend noch einheitlicher. dimensional, ohne jegliche Flexibilität.
Darüber hinaus erweist sich das Spielen nur in Nebenrollen als zusätzliche Bremse für die Entwicklung der Initiative seiner konformen Partner und gleichzeitig für die so wichtige Fähigkeit, das Spiel kreativ zu entwickeln. Und als Folge davon kann das Kind abhängiges Verhalten entwickeln (da es keine Wahl hat) und unerwünschte Eigenschaften wie Schmeichelei, Unterwürfigkeit, List und abhängige Motivation entwickeln.
Wenn egoistische, autoritäre Bestrebungen vorherrschen, führt deren Diskrepanz mit den demokratischen Tendenzen der Partner zur Entstehung von Konflikten in zwischenmenschlichen Beziehungen. Seine Originalität besteht darin, dass es keine intrapersonalen Konflikte verursacht: Die wesentlichen Bedürfnisse des Führers und seiner Partner werden ständig befriedigt. Der Widerspruch in den Motiven betrifft sie nicht und wird daher von Kindern nicht erkannt, was zur verborgenen (völlig) Natur eines solchen Konflikts beiträgt.
Das Blockieren eines Bedürfnisses verzerrt einerseits die persönliche Entwicklung des Kindes und trägt andererseits zur Entstehung unerwünschter Verhaltensmerkmale bei: Selbstzweifel, Misstrauen gegenüber Gleichaltrigen, Empfindlichkeit, Unhöflichkeit und sogar Elemente aggressiven Verhaltens Andererseits wirkt es sich negativ auf die Aktivität des Kindes aus und verringert seine Aktivität im Klassenzimmer mit seinem objektiven Besitz des notwendigen Wissens stark.
Wenn die Leitbedürfnisse des Kindes nicht befriedigt werden, wird die Entwicklung des Selbstbewusstseins erheblich gestört, Selbstvertrauen und Fähigkeiten werden stark reduziert und das Selbstwertgefühl nimmt ab. Dadurch wird der Prozess der Selbstregulation des Kindes und damit seine persönliche Kreativität im Sinne von L.I. gehemmt. Antsyferova. Äußerst wichtig ist in diesem Zusammenhang das Vorhandensein einer Harmonie zwischen den Anforderungen von Gleichaltrigen und den objektiven Spielfähigkeiten des Kindes sowie zwischen den Leitbedürfnissen des Kindes und der Gleichaltrigen.
Daher hemmt ein Konflikt in den Spielmotiven die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit ebenso wie eine Diskrepanz in den Spielabläufen. Die Ergebnisse der Arbeit vieler Autoren zeigen, dass ein nicht befriedigtes Bedürfnis eines Kindes nach Kommunikation oder gemeinsamen Aktivitäten mit Gleichaltrigen im Vorschulalter in keiner Weise kompensiert wird, was zu schwierigen Erfahrungen und einem Zustand extremer emotionaler Belastung für das Kind führt.
1.3 SchaffungBedingungenFürEntwicklungFähigkeitenkonfliktfreiVerhaltenKinder
Die Fähigkeit zum konfliktfreien Verhalten ist eine gut erlernte und automatisierte Handlungsweise in einer bestimmten Situation. Das Problem der Bildung konfliktfreien Verhaltens wurde von A.V. Zaporozhets, T.E. Sucharew, A.A. Royak, R.V. Ovcharova, A.N. Leontjew. Laut diesen Autoren gibt es viele Formen der Entwicklung von Konfliktlösungsfähigkeiten im Vorschulalter, wobei das Spielen an erster Stelle steht.
Spielbeziehungen sind für die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes, für seine Aneignung elementarer Normen von besonderer Bedeutung, da hier die erlernten Normen und Verhaltensregeln gebildet und tatsächlich manifestiert werden, die die Grundlage für die moralische Entwicklung eines Kindes bilden Vorschulkind und entwickeln die Fähigkeit, in einer Gruppe von Gleichaltrigen zu kommunizieren. Bondarenko A.K., Matusin A.I. Kinder erziehen durch Spielen. - M.: Bildung. Spielen wird zu einer der Hauptaktivitäten des Kindes, bei der es lernt, mit Gleichaltrigen zu kommunizieren. Das Spiel ist eines davon wirksame Formen die Arbeit eines Lehrers, der dazu beiträgt, Konflikte zwischen Kindern zu verhindern.
Das Spiel ermöglicht dem Kind das Modellieren Lebenssituationen, verlieren Verschiedene Optionen Verhalten während eines Konflikts und hilft, eine negative Kommunikationssituation emotional distanziert zu betrachten.
Spielaktivität ist eine Form der Aktivität in bedingten Situationen, die auf die Wiederherstellung und Assimilation sozialer Erfahrungen abzielt, die in sozial festgelegten Methoden zur Durchführung objektiver Handlungen in Fächern der Wissenschaft und Kultur festgelegt sind.
Im Spiel, als einer besonderen Form sozialer Praxis, werden Normen reproduziert Menschenleben sowie die intellektuelle, emotionale und moralische Entwicklung des Einzelnen. Im Prozess der Spielaktivitäten werden Fähigkeiten zur Konfliktlösung ausgebildet; es kommt zu einer Umstrukturierung des Verhaltens – es wird willkürlich; beim Spielen erfüllt das Kind zwei Funktionen gleichzeitig: Einerseits erfüllt es seine Rolle und andererseits kontrolliert es sein Verhalten. Die den menschlichen Beziehungen zugrunde liegenden Normen werden durch spielerisches Training zu einer Quelle für die Entwicklung des eigenen Verhaltens des Kindes.
Jeder der Vorschulkinder kann im Verhältnis zum anderen die Rolle des Älteren, des Gleichen oder des Jüngeren in seinem eigenen psychologischen Status spielen. Wenn ein Vorschulkind die ihm zugewiesene Rolle akzeptiert, kommt es nicht zu einem Rollenkonflikt. Daher ist es im Spiel wichtig zu verstehen, welche Rolle der Vorschulkind spielt und welche Rolle er erwartet. Psychologisch gesehen ist die Rolle eines Seniors oft die bequemste. Diese Rolle ist jedoch möglicherweise konfliktreicher, da genau diese Rolle anderen am häufigsten nicht passt. Er will nicht die Rolle des Jüngeren spielen. Daher sollte der Lehrer bei der Organisation von Rollenspielen die Verteilung dominanter Rollen vermeiden. Der günstigste Weg, Rollenkonflikten vorzubeugen, ist die gleichberechtigte Interaktion von Vorschulkindern. Bondarenko A.K., Matusin A.I. Kinder erziehen durch Spielen. - M.: Bildung.
Das Spiel wirkt nur äußerlich unbeschwert und einfach. Tatsächlich verlangt sie jedoch gebieterisch, dass der Spieler ihr das Maximum an Energie, Intelligenz, Ausdauer und Unabhängigkeit gibt. Technologie Spielmethoden Prävention zielt darauf ab, Vorschulkindern beizubringen, die Motive ihres Verhaltens im Spiel und im Leben zu verstehen, d.h. Ziele für selbständiges Handeln formulieren.
IN pädagogische Tätigkeit Bei der Konfliktprävention zwischen Vorschulkindern kommen verschiedene Methoden, Techniken und Mittel zum Einsatz.
Einer der Bereiche ist die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeiten von Kindern mit Gleichaltrigen, darunter:
Erstens die Vermittlung grundlegender sozialer Fähigkeiten: die Fähigkeit, einem anderen zuzuhören und Interesse an ihm zu zeigen, ein allgemeines Gespräch zu führen, an einer gemeinsamen Diskussion teilzunehmen, einen anderen taktvoll zu kritisieren und zu loben, ihnen beizubringen, in schwierigen Situationen, einschließlich Konflikten, gemeinsam nach für beide Seiten vorteilhaften Lösungen zu suchen Situationen und schult die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen.
Zweitens: Bringen Sie dem Kind bei, den Maßstab der Perfektion nicht auf andere oder sich selbst anzuwenden, keine Anschuldigungen oder Selbstgeißelungen zuzulassen und auch den Wunsch zu entwickeln, ständig in Kontakt zu bleiben, und zu lernen, aus gescheiterter Kommunikation zu lernen.
Drittens muss dafür gesorgt werden, dass Kinder Folgendes lernen:
a) Methoden zur Selbstregulierung ihres Zustands, die es ihnen ermöglichen würden, der Macht des Konflikts zu entkommen und dadurch ihre soziale Flexibilität wiederherzustellen. Die Beherrschung von Selbstregulierungstechniken hilft dem Kind, seinen Ton rechtzeitig zu senken, anstatt nutzlos zu beweisen, dass es Recht hat, oder zu versuchen, in einer Konfliktsituation eine Einigung zu erzielen, anstatt darauf mit Beleidigung und Rückzug aus der Kommunikation zu reagieren;
b) die Fähigkeit, seine Gefühle zu kontrollieren, die emotionalen Zustände anderer Menschen zu verstehen und zwischen ihnen zu unterscheiden;
c) freundliche Gefühle, Sympathie, Sympathie und Empathie für andere ausdrücken.
Wir schlagen vor, die folgenden Methoden, Techniken und Formen als Hauptmethoden, Techniken und Formen zu verwenden, um Kindern konstruktive Wege zur Lösung von Konfliktsituationen beizubringen:
a) handlungstechnisch – Rollenspiele(bei Vorliegen einer problematischen Situation);
b) Nachahmungsspiele (Simulieren in „ reiner Form„irgendein“ menschlicher „Prozess);
c) interaktive Spiele (Interaktionsspiele);
d) Sozial- und Verhaltenstrainings;
e) Konfliktsituationen durchspielen und Auswege modellieren;
f) Psychogymnastik;
g) Lektüre und Diskussion von Kunstwerken;
h) Diskussionen.
Ein Lehrer im spielerischen Umgang mit Kindern kann ihnen helfen, ihre Werte zu erkennen und Prioritäten zu setzen, kann ihnen aber auch dabei helfen, tolerant, flexibel und aufmerksam zu werden, weniger Angst und Stress zu erleben und sich weniger einsam zu fühlen.
Er kann ihnen einfache Lebensweisheiten beibringen:
Menschliche Beziehungen sind von großem Wert und es ist wichtig, sie aufrechtzuerhalten, damit sie sich nicht verschlechtern;
Erwarten Sie nicht, dass andere Ihre Gedanken lesen und ihnen sagen, was Sie wollen, fühlen und denken.
Beleidigen Sie andere Menschen nicht und lassen Sie nicht zu, dass sie „das Gesicht verlieren“;
Greife andere nicht an, wenn es dir schlecht geht.
Bei der Schaffung von Bedingungen für die Entwicklung konfliktfreier Verhaltensfähigkeiten muss der Lehrer bedenken, dass Konfliktprävention am effektivsten durch gemeinsame Aktivitäten der Kinder im Klassenzimmer erfolgt. Gemeinsame Aktivitäten vereinen Kinder mit einem gemeinsamen Ziel, einer gemeinsamen Aufgabe, Freuden, Sorgen und Gefühlen für eine gemeinsame Sache. Es gibt eine Verteilung der Verantwortlichkeiten und eine Koordination der Aktionen. Durch die Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten lernt ein Vorschulkind, den Wünschen seiner Mitschüler nachzugeben oder sie davon zu überzeugen, dass er Recht hat, und sich für ein gemeinsames Ergebnis einzusetzen. Lisetsky M.S. Psychologie zwischenmenschlicher Konflikte im höheren Vorschulalter./M.S. Lisetsky - M.: Samara. 2006.
2. ExperimentalForschungEntwicklungFähigkeitenkonfliktfreiVerhaltenbedeutetSpielAktivitätenbeiKinderSeniorVorschuleAlter
2.1 AufschlussreichEbeneKonfliktVerhaltenbeiKinderSeniorVorschuleAlter
Das Experiment wurde auf der Grundlage der staatlichen Bildungseinrichtung Lyzeum Nr. 1557 in Selenograd durchgeführt. Daran nahmen 20 Kinder der älteren Gruppe (8 Jungen und 12 Mädchen) im Alter von 5 bis 6 Jahren teil. Das Experiment bestand aus drei Phasen – Feststellung, Gestaltung und Kontrolle. Forschung wurde über 3 Monate durchgeführt.
Basierend auf einer theoretischen Analyse der psychologischen und pädagogischen Literatur zum Forschungsproblem haben wir folgende Hypothese formuliert: Der Prozess der Entwicklung von Fähigkeiten zum konfliktfreien Verhalten bei Kindern im höheren Vorschulalter wird durch die gezielte Schaffung der folgenden psychologischen und wirksamen Maßnahmen wirksam Pädagogische Voraussetzungen: - Einsatz eines Komplexes interaktiver Spiele in der Arbeit mit Kindern mit dem Ziel, Zusammenhalt und Zusammenarbeit zu bilden, effektive Kommunikationswege zu vermitteln, einen Anspruch auf soziale Anerkennung zu bilden und Konflikte bei Kindern zu lindern;
...Ähnliche Dokumente
Ästhetische Ausbildung als Mittel zur Entwicklung vielseitige Persönlichkeit Kind. Inhalt, Konzept, Formen und Merkmale der Organisation von Theateraktivitäten im höheren Vorschulalter. Merkmale der Entwicklung von Kindern im höheren Vorschulalter.
Dissertation, hinzugefügt am 21.05.2010
Sportunterricht von Vorschulkindern. Merkmale der Technik Sportunterricht Kinder im frühen Vorschulalter, Vorschulalter und höheren Vorschulalter. Regelmäßigkeiten des Sportunterrichts und der Persönlichkeitsbildung eines Kindes.
Kursarbeit, hinzugefügt am 09.03.2015
Die Wirkung des Skifahrens auf den Körper. Methoden des Skiunterrichts im Vorschulalter, seine Formen und Ziele, die Schaffung günstiger Lernbedingungen. Grundkriterien für die Richtigkeit eines Schiebetritts. Organisierter Skiunterricht.
Test, hinzugefügt am 29.05.2009
Denken als geistiger kognitiver Prozess, Merkmale seiner Entwicklung im Vorschulalter. Experimentelle Untersuchung der Entwicklung des visuell-figurativen Denkens im Vorschulalter, Empfehlungen für Eltern und Erzieher zu seiner Entwicklung.
Kursarbeit, hinzugefügt am 03.10.2010
Bedeutung Arbeitserziehung bei der ganzheitlichen Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit. Merkmale der Ausbildung von Arbeitsfähigkeiten bei Kindern im höheren Vorschulalter während des Dienstes. Methoden zur Organisation der Arbeit von Betreuern im höheren Vorschulalter.
Kursarbeit, hinzugefügt am 24.06.2011
Unterrichten von Sicherheitsthemen für Kinder. Entwicklung der Fähigkeiten des Kindes für angemessenes Verhalten in verschiedenen unerwarteten Situationen. Theoretische Grundlagen der Vermittlung von Lebenssicherheit und Verkehrsregeln im höheren Vorschulalter. Programm „Grundlagen der Sicherheit für Vorschulkinder“.
Kursarbeit, hinzugefügt am 27.02.2009
Methoden und Techniken zur Lehrerführung von Theaterspielen im Vorschulalter als Gegenstand wissenschaftlicher Erkenntnisse. Theaterspiel als eine der Spielarten für Vorschulkinder. Die Bedeutung von Theaterspielen für die umfassende Entwicklung eines Kindes.
Kursarbeit, hinzugefügt am 01.06.2014
Merkmale der Organisation eines gemeinsamen Lebensstils für ältere Vorschulkinder. Moralische Erziehung von Kindern im Vorschulalter. Förderung einer Verhaltenskultur und positiver Beziehungen bei Kindern. Entwicklung der Kommunikation mit Gleichaltrigen.
Kursarbeit, hinzugefügt am 30.11.2006
Die wichtigsten pädagogischen Ansätze zur Entwicklung einer Verhaltenskultur im Kindergarten. Methodik zur Entwicklung einer Verhaltenskultur im höheren Vorschulalter (Senioren und Vorbereitungsgruppe). Förderung einer Verhaltenskultur im Sinne moderner Etikette.
Zusammenfassung, hinzugefügt am 21.04.2010
Korrekturmöglichkeiten von Spielaktivitäten. Entwicklung des Kindes als Subjekt der Spielaktivität. Abweichendes Verhalten und seine Korrektur im Vorschulalter. Bedingungen für die Entwicklung von Spielaktivitäten in einer experimentellen Vorschuleinrichtung.
Ausbildung konfliktfreier Verhaltensfähigkeiten
Grundvoraussetzungen für effektives Konfliktmanagement im Lehrbetrieb:
- Aufdeckung der Konfliktursachen durch den Lehrer;
- Konfliktbewusstsein des Lehrers;
- unter Berücksichtigung der Merkmale der sozialen Erfahrung der Konfliktteilnehmer;
- Fähigkeit zur Vorhersage Möglichkeiten Verhalten von Konfliktteilnehmern in späteren Lebenssituationen.
Es gibt vier mögliche Strategien zur Konfliktbewältigung in der Arbeit eines Lehrers:
A. Prävention.
B. Unterdrückung.
B. Verschiebung.
D. Erlaubnis.
Schauen wir sie uns genauer an.
A. Konfliktpräventionsstrategie: Analysieren Sie die Konfliktsituation und beseitigen Sie den eigentlichen Konfliktgegenstand.
B. Strategien zur Konfliktunterdrückung, die bei Konflikten in einer irreversibel destruktiven Phase und bei sinnlosen Konflikten angewendet werden:
- Reduzieren Sie gezielt und konsequent die Zahl der Konfliktpersonen.
- Entwickeln Sie ein System von Regeln, Normen und Vorschriften, das die Beziehungen zwischen Menschen (Kindern) regelt, die potenzielle Konflikte miteinander haben.
- Bedingungen schaffen und kontinuierlich aufrechterhalten, die eine direkte Interaktion zwischen Menschen (Kindern) erschweren oder verhindern, die potenzielle Konflikte miteinander haben.
B. Verzögerungsstrategien sind vorübergehende Maßnahmen, die nur dazu beitragen, den Konflikt zu entschärfen, damit er später, wenn die Bedingungen dafür reif sind, gelöst werden kann:
1. Ändern Sie die Haltung des Lehrers gegenüber der Konfliktpartei:
a) die Stärke einer oder beider Konfliktparteien in der Vorstellung der Gegenseite verändern;
b) die Rolle oder den Platz eines der Konfliktparteien in der Vorstellung des anderen verringern oder erhöhen.
- Ändern Sie das Verständnis des Lehrers für die Konfliktsituation (die Bedingungen des Konflikts, die Beziehungen der damit verbundenen Personen usw.).
- Ändern Sie die Bedeutung (Charakter, Form) des Konfliktobjekts in der Vorstellung des Lehrers und machen Sie es dadurch weniger konflikthaft (verringern oder erhöhen Sie den Wert des Konfliktobjekts, wodurch es möglicherweise unnötig oder unerreichbar wird).
Überlegen Sie, wo und wie Sie die oben genannten Strategien nutzen könnten? Wie konstruktiv ist das?
D. Grundsätze der Konfliktlösung. 1. Konfliktverständnis, also Bewusstsein für das eigentliche Problem, die Kräfteverhältnisse im Konflikt, den Konfliktgegenstand, Kenntnis schwieriger Persönlichkeiten, Orientierung in den Phasen des Konflikts:
a) Eskalationsphase (es ist möglich, die Entwicklung eines Konflikts bereits im Stadium seiner Entstehung erfolgreich zu blockieren. Eine davon effektive Wege Den Konflikt blockieren – ihn von der Kommunikationsebene auf die Aktionsebene übertragen. Wenn Sie beispielsweise bemerken, dass die Spannung zwischen zwei Schülern zunimmt, geben Sie beiden eine Aufgabe.
b) Umsetzungsphase (Leidenschaften toben, Teilnehmer sind begeistert und demonstrieren „Power-Techniken“ auf jede erdenkliche Weise. Es empfiehlt sich, jedem Teilnehmer die Möglichkeit zu geben, sich separat zu äußern);
c) Abklingphase (die Konfliktparteien haben ihre Kraft und Energie erschöpft. In dieser Phase können die Konfliktursachen identifiziert und beseitigt sowie das Problem gelöst werden).
2. Antizipation von Konflikten, d. h. Vorhersage potenzieller Konflikte; Vorhersage des Verhaltens einer schwierigen Persönlichkeit in einem Konflikt.
Lassen Sie uns näher auf taktische Methoden der Konfliktlösung eingehen. Dazu gehören allgemeine Empfehlungen, Merkmale nonverbaler Verhaltenstaktiken und Möglichkeiten zur Gesprächsführung.
- Natürlichkeit;
- Toleranz gegenüber den Schwächen des Gesprächspartners;
- Sympathie für ihn, Teilnahme;
- Ausdauer und Selbstbeherrschung;
- ruhiger Ton;
- Prägnanz und Lakonismus.
Es ist notwendig, Phrasen so zu konstruieren, dass sie beim Gesprächspartner eine neutrale oder positive Reaktion hervorrufen. Vermeiden persönliche Einschätzungen, wie: „Ich hätte nie gedacht, dass du so unhöflich bist.“ Dazu können Sie Ihre Gefühle in Worte fassen: „Wenn Sie X in Situation Y tun, dann. Ich fühle Z (Wut, Irritation, Aggression, Enttäuschung, Traurigkeit, Freude, Glück, Inspiration, Leichtigkeit, Hochgefühl, Ruhe usw.).“ Die meisten bemerken, dass nach diesem Satz Ruhe und eine nüchterne Einschätzung der Situation eintreten;
9) Erhöhen Sie den Rhythmus und das Tempo des Gesprächs leicht, wenn der Gesprächspartner übermäßig aufgeregt ist oder zu schnell spricht.
- Versuchen Sie, sich mental in die Lage Ihres Partners zu versetzen und zu verstehen, welche Ereignisse ihn in einen solchen Zustand geführt haben.
- Versuchen Sie zu fühlen: „Wie würde es für mich in diesem Zustand sein?“;
- Denken Sie daran, dass es manchmal keine richtigen oder falschen Positionen oder Antworten gibt.
B. Nonverbales Verhalten:
- Lassen Sie sie zu Wort kommen, vermeiden Sie es zu schreien oder zu unterbrechen;
- Hör genau zu;
- pausieren, wenn der Gesprächspartner zu aktiv ist;
- zeigen Sie, dass Sie den Zustand des Gesprächspartners verstehen (nicken, sich leicht zum Gesprächspartner neigen usw.);
5) Abstand verringern, Positionen ausgleichen (annähern, ggf. hinsetzen, berühren, evtl. lächeln).
B. Möglichkeiten der Gesprächsführung:
- grüße den Gesprächspartner freundlich;
- Bieten Sie an, sich zu setzen (und setzen Sie sich möglichst in einem spitzen oder rechten Winkel zum Gesprächspartner, nicht zu weit von ihm entfernt, vermeiden Sie Barrieren zwischen Ihnen in Form eines Tisches, Schreibtisches usw.);
- Sprechen Sie über Ihr Wohlbefinden, den Zustand, den die Worte des Gesprächspartners bei Ihnen verursacht haben;
- über den Zustand und das Wohlbefinden des Gesprächspartners sprechen;
- sich den Fakten zuwenden (emotionale Einschätzungen vermeiden);
- Fehler zugeben, wo sie vorhanden sind;
- Geben Sie zu, dass Ihr Gesprächspartner in den Punkten Recht hat, in denen er zweifellos Recht hat;
- Geben Sie Ihrem Gesprächspartner das Gefühl, dass Sie verstehen, wie wichtig das Thema ist, über das er spricht.
- betonen Sie die Gemeinsamkeit von Interessen, Zielen, Aufgaben mit dem Gesprächspartner;
- zeigen Sie, dass Sie an der Lösung des Problems interessiert sind;
- die Verantwortung für die Lösung des Problems mit dem Gesprächspartner teilen;
- Beachten Sie, dass Sie Ihrem Gesprächspartner vertrauen.
- betonen beste Qualitäten ein Partner, der Ihnen bei der Lösung des Problems hilft;
- beachten Sie die Bedeutung des Partners, seinen Platz, seine Rolle in der Gruppe, seine starken Eigenschaften und die gute Einstellung anderer ihm gegenüber;
- Fragen Sie Ihren Gesprächspartner um Rat, was er in dieser Situation an Ihrer Stelle tun würde.